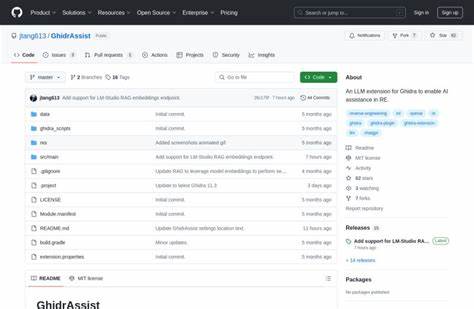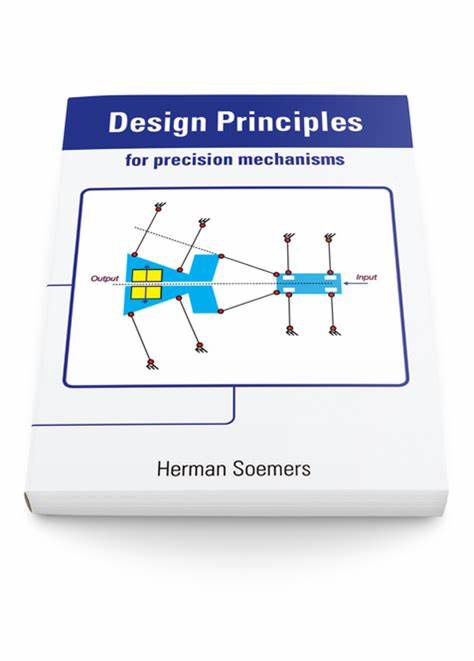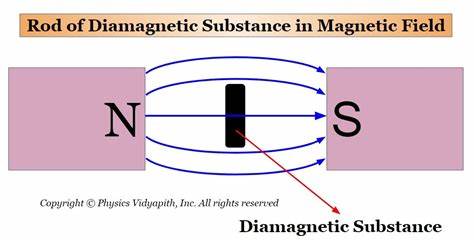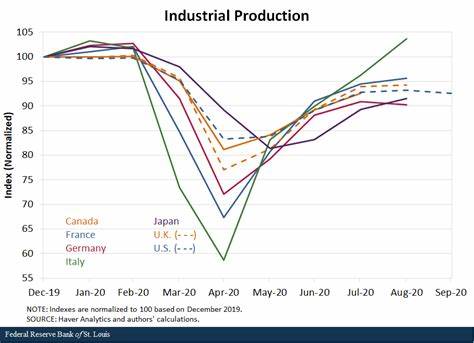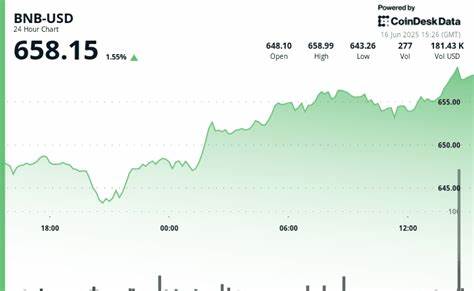Die präzise Dosierung von Anästhetika stellt einen entscheidenden Faktor für den Erfolg chirurgischer Eingriffe dar. Besonders bei pädiatrischen Patienten – also Kindern – ist die Herausforderung groß, da ihre physiologischen Parameter deutlich vom Erwachsenenalter abweichen und die individuelle Wirkung von Narkosemitteln besonders schwer vorherzusagen ist. Eine zu niedrige Dosierung kann das Risiko des Aufwachens während der Operation erhöhen, während eine Überdosierung schwerwiegende Nebenwirkungen und Komplikationen nach sich ziehen kann. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung verlässlicher und schneller Überwachungsmethoden von zentraler Bedeutung für die Anästhesie bei Kindern. Die klassische Herangehensweise zur Bestimmung der Anästhetikum-Dosierung basiert auf allgemeinen Richtwerten wie Alter, Gewicht und Körpergröße des Patienten.
Während der Operation beurteilen Anästhesisten zudem indirekte Indikatoren wie Vitalzeichen, Bewegungen oder aufgezeichnete Hirnaktivitäten, um die Wirksamkeit und Tiefe der Narkose abzuschätzen. Doch bis dato gibt es keine direkte, schnelle Methode, um den tatsächlichen Arzneimittelspiegel im Körper zu messen – insbesondere nicht im Gehirn, dem Hauptwirkungsort der Anästhetika. An der Universität Basel wurde nun eine bahnbrechende Pilotstudie durchgeführt, die zeigt, dass eine detaillierte Analyse der ausgeatmeten Atemluft eine präzise und nahezu Echtzeit-Kontrolle der Propofol-Konzentration im Körper von Kindern ermöglicht. Propofol ist eines der am häufigsten eingesetzten Anästhetika zur Einleitung und Aufrechterhaltung einer Vollnarkose und ist seit über 30 Jahren etabliert. Die Herausforderung bei der Dosierung besteht darin, dass die Wirkstoffkonzentration im Gehirn nicht direkt gemessen werden kann und bislang nur grob über biophysiologische Parameter geschätzt wird.
Die Atemanalyse basiert darauf, dass der menschliche Atem eine Vielzahl winziger Moleküle enthält, darunter Stoffwechselprodukte sowie Arzneistoffe und deren Abbauprodukte. Dank hochentwickelter Technologien wie der Massenspektrometrie ist es möglich, diese Bestandteile exakt zu identifizieren und zu quantifizieren. Das Forscherteam um Professor Pablo Sinues hat in Kooperation mit der Kinderklinik Basel diese Methode praktisch erprobt. Während der Narkose wurden bei zehn Kindern repetitive Atem- und Blutproben entnommen und miteinander verglichen. Ein spezielles Plastikbeutel-System ermöglichte die Erfassung der ausgeatmeten Luft, die anschließend im Labor analysiert wurde.
Obwohl das Massenspektrometer aktuell noch nicht direkt im Operationssaal eingesetzt werden kann, zeigte die Untersuchung eine exzellente Übereinstimmung zwischen den gemessenen Propofol-Konzentrationen im Atem und im Blut. Diese Erkenntnis ist wegweisend, denn dadurch lässt sich die Dosierung von Propofol in Zukunft sehr viel zielgerichteter steuern — ganz ohne invasive Blutentnahmen. Darüber hinaus liefert die Atemanalytik zusätzliche wertvolle Einblicke in die physiologischen Reaktionen des Körpers auf die Anästhesie und den chirurgischen Eingriff selbst. So wurden im Atem auch Marker für Stressreaktionen entdeckt, insbesondere solche, die auf oxidativen Stress hinweisen. Oxidativer Stress entsteht, wenn im Körper das Gleichgewicht zwischen freien Radikalen und antioxidativen Substanzen gestört ist, was häufig bei Operationen auftritt und zu Gewebeschäden führen kann.
Die Erfassung dieser Stresssignale in Echtzeit eröffnet neue Möglichkeiten, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen und gezielte Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese innovative Methode könnte insbesondere jene seltenen, aber dramatischen Nebenwirkungen von Propofol bei Kindern besser kontrollierbar machen. Eine frühzeitige Detektion atypischer Reaktionen anhand der Atemanalysen kann lebensrettend sein und die Sicherheit der Patienten erheblich verbessern. Die Vorteile der nicht-invasiven Atemanalyse liegen auf der Hand: Sie ist schmerzfrei, erfordert keine Blutabnahme und kann theoretisch kontinuierlich angewendet werden. Gerade bei Kindern, bei denen Blutentnahmen oft traumatisierend und belastend sind, stellt dies einen enormen Fortschritt dar.
Auch ältere Patienten oder chronisch Kranke könnten von dieser Überwachungsmethode profitieren. Die Forschungsgruppe hat bereits zuvor gezeigt, dass sich Atemanalysen für die individuelle Dosierung weiterer Medikamente eignen, etwa Epilepsiemedikamenten. Dort konnte nachgewiesen werden, dass sich sowohl Wirkstoffe als auch ihre Abbauprodukte in der Atemluft identifizieren lassen, was eine gezielte Anpassung der Medikation ermöglicht. Ebenso wurden Atemanalysen zur Erfassung des Gesundheitszustands von Kindern mit Diabetes eingesetzt. Mit Blick auf die Zukunft ist zu erwarten, dass Massenspektrometrie-Geräte noch kompakter und schneller werden, was den Einsatz direkt im Operationssaal oder sogar am Krankenbett ermöglichen könnte.
Eine direkte Echtzeit-Analyse würde die Individualisierung der Anästhesie massiv vorantreiben. Zusätzlich könnten Algorithmen und Künstliche Intelligenz die große Menge an Atemdaten interpretieren und Empfehlungen für das Anästhesieteam geben. Die potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklung sind enorm. Durch bessere Überwachung kann nicht nur die Dosierung präziser gesteuert werden, sondern auch postoperative Komplikationen reduziert und Heilungsprozesse optimiert werden. Außerdem trägt die Methode dazu bei, unnötige Medikamentengaben und somit Nebenwirkungen und Kosten zu minimieren — ein bedeutender Fortschritt gerade im Bereich der Kinderanästhesie, wo Sicherheit und Schonung höchste Priorität haben.
Das Konzept, über die Atemluft einen direkten Einblick in die Verstoffwechselung und Wirkung von Medikamenten zu erhalten, stellt eine neue Dimension in der Medizin dar. Pauschale Dosierungsregeln könnten bald der Vergangenheit angehören und durch personalisierte, auf Echtzeitdaten basierende Therapien ersetzt werden. Besonders in der Kinderheilkunde, wo individuelle Unterschiede und Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten hoch sind, bietet die Atemanalyse einen vielversprechenden Ansatz für eine verbesserte Patientenversorgung. Die Erforschung und Weiterentwicklung dieser Technologie wird weiterhin intensiv betrieben. Langfristig könnten standardisierte Atemanalysen auch bei anderen medizinischen Anwendungen, beispielsweise im Bereich der Schmerztherapie, Intensivmedizin oder bei chronischen Erkrankungen, eingesetzt werden.
Die enge Zusammenarbeit interdisziplinärer Teams aus Biomedizintechnik, Pädiatrie, Anästhesie und Datenwissenschaft wird hier ein zentraler Erfolgsfaktor sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der ausgeatmeten Luft ein einzigartiges Fenster bietet, um nicht nur den aktuellen Medikamentenspiegel bei Kindern während der Operation genau zu bestimmen, sondern auch die physiologischen Reaktionen auf Anästhesie und chirurgischen Stress sichtbar zu machen. Diese Innovation könnte die Sicherheit von Narkosen bei Kindern deutlich erhöhen und die Grundlage für eine personalisierte Anästhesie legen – ein bedeutender Schritt hin zu schonenderen und effektiveren Behandlungsverfahren im Krankenhausalltag.