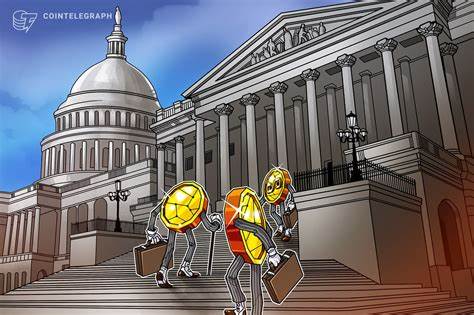In den letzten Jahren ist das Thema Fast Fashion zu einem der drängendsten Umweltprobleme geworden. Schnelle Modeströmungen produzieren eine immense Menge preiswerter Kleidung, die oft nur wenige Male getragen wird, bevor sie als Müll endet. Ein erschütterndes Beispiel für die globalen Auswirkungen dieses Konsumverhaltens ist die Entdeckung großer Mengen britischer Fast-Fashion-Kleidungsstücke in einem geschützten Feuchtgebiet in Ghana. Diese Situation zeigt nicht nur die Schattenseiten des Modekonsums auf, sondern offenbart auch die verheerenden Folgen für sensible Ökosysteme und die Menschen vor Ort.Das Densu Delta in der Nähe der Hauptstadt Accra gilt als international bedeutsames Feuchtgebiet.
Als Ramsar-Schutzgebiet hat es besondere ökologische Bedeutung, beheimatet seltene Vogelarten und Meeresschildkröten wie die bedrohten Arten Lederschildkröte und Grüner Meeresschildkröte. Die Feuchtgebiete unterstützen das Ökosystem, bieten Lebensraum für unzählige Tierarten und sind für die lokale Bevölkerung eine wichtige Lebensgrundlage, vor allem durch Fischfang und Salzgewinnung.Doch diese Idylle ist bedroht. Journalisten von Greenpeace Africa und Unearthed fanden auf in diesem Schutzgebiet illegal angelegte Müllhalden, in denen sich tonnenweise Textilabfälle stapeln. Viele Kleidungsstücke stammen von bekannten britischen Marken wie Next, George bei Asda, Marks & Spencer, Primark, Zara und H&M.
Diese „Fast Fashion-Gräber“ wachsen rapide und verschmutzen nicht nur den Boden, sondern auch die Wasserwege, was gravierende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Gesundheit der Bevölkerung hat.Die Herkunft dieser Kleidungsstücke liegt zu einem großen Teil im Export von gebrauchten Textilien aus Europa, insbesondere Großbritannien, nach Ghana. Das Land ist einer der weltweit größten Importeure von Second-Hand-Kleidung. Dies hat jedoch einen hohen Preis: Rund 40 Prozent der importierten Kleidung sind unbrauchbar – beschädigt, verschmutzt oder für das tropische Klima ungeeignet. Dies führt zu einer massiven Überlastung der lokalen Entsorgungssysteme und zum Entstehen illegaler Müllhalden, auch in ökologisch sensiblen Gebieten wie dem Densu Delta.
Die schlechten Entsorgungsbedingungen bringen enorme ökologische und soziale Probleme mit sich. Die Textilien bestehen überwiegend aus synthetischen Fasern, die auf Erdöl basieren und Jahrhunderte benötigen, um sich zu zersetzen. Während des Verfalls setzen sie Mikroplastikpartikel und giftige Chemikalien frei, die in die Umwelt, ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen können. Untersuchungen zeigen, dass diese Gebiete bereits stark verschmutzt sind und das Mikroplastik in Meereslebewesen wie Austern im Golf von Guinea nachgewiesen wurde.Auch die lokale Bevölkerung leidet unter der Verschmutzung.
Fischer klagen, dass es schwerer wird, Fische zu fangen, da ihre Netze durch verfangene Kleidungsstücke und Plastikmüll beschädigt werden. Die Luftqualität und die Wasserreinheit verschlechtern sich, was zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen und Hautproblemen führt. Die schlechte Müllentsorgung sorgt außerdem für einen unzumutbaren Geruch, der das Leben in den angrenzenden Gemeinden stark beeinträchtigt.Die Textilabfälle stammen aus einem globalen System, das die Verantwortung für den Lebenszyklus von Kleidungsstücken oft ignoriert. Fast Fashion beruht auf dem Prinzip der schnellen und preisgünstigen Produktion und Vermarktung von Kleidung mit kurzen Tragezeiten, was zu einem enormen Materialverbrauch und großen Mengen von Abfall führt.
In Großbritannien konsumieren Menschen durchschnittlich rund 26 Kilogramm Kleidung pro Jahr, was deutlich über anderen europäischen Ländern liegt. Darunter sind viele Kleidungsstücke minderer Qualität, die schneller kaputtgehen und schneller entsorgt werden.Trotz dieser Erkenntnisse zeigen sich die betroffenen britischen Marken unterschiedlich in ihrer Haltung zum Problem. Einige, wie Marks & Spencer und George bei Asda, weisen auf eigene Rückgabe- und Recyclingprogramme hin, mit welchen sie den Kreislauf der Textilien fördern wollen. Auch Primark betont, keine Kleidungsstücke von Rücknahmesystemen in solche Exporte zu schicken.
H&M, Zara und George sprechen sich für ein erweitertes Produzentenverantwortungssystem (Extended Producer Responsibility – EPR) aus, um Modemarken stärker für die Abfallproblematik ihrer Produkte in die Pflicht nehmen zu können. Jedoch besteht weiterhin Kritik, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht konsequent umgesetzt werden.Ein weiteres Problem in Ghana ist die mangelnde Infrastruktur zur Abfallbewältigung. Die städtischen Deponien sind meist überfüllt und verfügen nicht über die notwendigen technischen Anlagen, um Schadstoffe zu binden oder den Austritt von Giftstoffen und Mikroplastik ins Grundwasser zu verhindern. Das führt zur unkontrollierten Ausbreitung von Müll in empfindlichen Ökosystemen, die eigentlich unter internationalem Schutz stehen.
Die mangelnde Kontrolle und der illegale Betrieb von Müllhalden im Densu Delta stellen ebenso einen Verstoß gegen nationale Schutzbestimmungen sowie internationale Verträge wie das Ramsar-Abkommen dar, die den Schutz von Feuchtgebieten regeln. Die lokale Verwaltung hat bis dato kaum wirksame Maßnahmen ergriffen, um das Problem einzudämmen oder die Herkunft der Müllansammlungen zu untersuchen. Dies führt zu Frustration in den Gemeinden, die einst in einem gesunden sowie produktiven Ökosystem lebten und heute mit den Folgen der Umweltzerstörung kämpfen.Auch die internationale Gemeinschaft erkennt die Textilabfall-Problematik zunehmend an. Länder wie Uganda haben bereits den Import von gebrauchter Kleidung eingeschränkt, da sie den heimischen Textilsektor bedroht sehen und das Recyclingproblem nicht lösen können.
In Europa und Großbritannien wird über die Einführung verbindlicher gesetzlicher Vorgaben diskutiert, die Hersteller verpflichten sollen, Verantwortung für die Wiederverwertung ihrer Produkte zu übernehmen und Abfall zu reduzieren. Solche Extended Producer Responsibility (EPR)-Systeme gelten als ein Mittel, um nachhaltigere Produktions- und Entsorgungsmechanismen zu fördern.Die globale Modeindustrie steht somit an einem Scheideweg. Der derzeitige Weg führt zu enormen Umweltbelastungen nicht nur in den Ursprungsregionen der Kleidungsproduktion, sondern auch in den Exportländern, die zunehmend als „Fast Fashion Friedhof“ fungieren. Die Menschheit muss dringend nachhaltigere Konsum- und Produktionsweisen etablieren, um den Schutz von Ökosystemen und die Lebensqualität von Gemeinschaften weltweit zu gewährleisten.
Dazu gehören strengere gesetzliche Rahmenbedingungen, mehr Transparenz in den Lieferketten, verbesserte Recyclingtechnologien und vor allem auch bewussterer Konsum.Die Situation im Densu Delta zeigt exemplarisch, welche weitreichenden Konsequenzen Fast Fashion und textile Abfallströme haben können. Der Schutz solcher sensiblen Naturräume ist von globaler Bedeutung, nicht nur wegen ihrer Biodiversität, sondern auch aufgrund ihrer Funktion für Klimaschutz, Hochwasserschutz und lokale Ernährungssicherheit. Nur ein Zusammenspiel aus internationaler Zusammenarbeit, verantwortungsvoller Unternehmensführung und gesellschaftlichem Engagement wird langfristig den nötigen Wandel herbeiführen können.Die Herausforderung besteht darin, Mode als integralen Teil des Lebens neu zu denken – weg von Wegwerf-Kultur hin zu Kreislaufwirtschaft und Respekt gegenüber Umwelt und Menschen.
Ghana und sein Densu Delta geben einen eindringlichen Hinweis darauf, dass Umweltverschmutzung und soziale Probleme oft Hand in Hand gehen. Deshalb ist jetzt ein Umdenken auf allen Ebenen gefragt, um die Erde auch für kommende Generationen lebenswert zu erhalten.