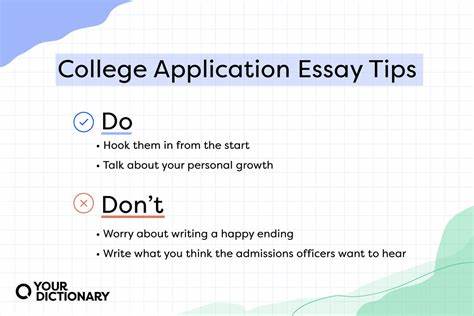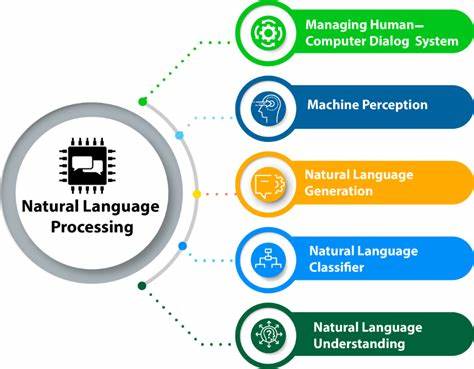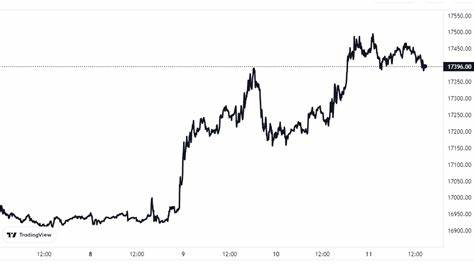Die Zulassung an Hochschulen ist seit Jahren ein komplexer und oft kontrovers diskutierter Prozess. In den letzten Jahrzehnten haben persönliche Bewerbungsaufsätze als fester Bestandteil der College-Bewerbung eine große Rolle gespielt. Ursprünglich wurden sie eingeführt, um Bewerbern eine Chance zu geben, Qualitäten und Erfahrungen darzustellen, die außerhalb von Noten und Testergebnissen liegen. Doch im Verlauf der Zeit hat sich diese Art des Essays gewandelt – von einer Möglichkeit zur individuellen Profilierung hin zu einem teilweise stark politisierten und standardisierten Verfahren, das zunehmend Diskussionen über Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Leistungsorientierung auslöst. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs der USA und der Debatten um Affirmative Action gewinnt das Thema neue Brisanz.
Der Supreme Court der USA hat 2023 mit einer 6-3-Mehrheit affirmative-action-Programme in der Hochschulzulassung weitgehend als unzulässig erklärt. Das Urteil führte zu einem Paradigmenwechsel, doch enthielt zugleich eine bemerkenswerte „Schlupfloch“-Regelung. Diese erlaubt es Hochschulen, im Rahmen ihrer Zulassungsverfahren weiter die individuelle Erfahrung von Bewerbern im Hinblick auf deren Rasse oder Diskriminierungserfahrung zu berücksichtigen – zumindest, wenn solche Erfahrungen in Essay-Form geschildert werden. Diese Nuance nutzten Institutionen wie Harvard umgehend und kündigten an, sich strikt an die Entscheidung zu halten, gleichzeitig aber die neue Chance zu nutzen, rassische und soziale Hintergründe weiterhin relevant einzubeziehen. Das hat zur Folge, dass der persönliche Bewerbungsaufsatz – einst ein freier, persönlicher Erzählraum – sich zunehmend zu einem Instrument der Identitäts- und Diversitätspolitik entwickelt hat.
Hochschulen verlangen gezielt Essays, in denen Herausforderungen, Diskriminierungen, persönliche Härten und die Zugehörigkeit zu Minderheitengruppen behandelt werden. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den formulierten Aufsatzfragen wider. So fordern viele Universitäten, darunter angesehene Einrichtungen in North Carolina, dass Bewerber über persönliche Qualitäten, Hindernisse oder positive gesellschaftliche Wirkungen innerhalb bestimmter Communities berichten. Der Begriff „Community“ wird dabei oft in einem politisch aufgeladenen Sinn verwendet – etwa als „LGBTQ+ Community“ oder „Schwarze Community“. Auf diese Weise entsteht ein Bewerbungsumfeld, das Bewerber unter Druck setzt, ihre Identität in politisch konformen Kategorien zu präsentieren.
Für Bewerberinnen und Bewerber aus Minderheitengruppen bietet dies einerseits die Möglichkeit, eigene Erfahrungen und Herausforderungen sichtbar zu machen, die bislang im rein akademischen Auswahlprozess kaum gewürdigt wurden. Doch für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft bzw. Nicht-Minderheiten entsteht ein Dilemma. Einige versuchen, ihre ‚privilegierte‘ Herkunft einzubringen und sich als Unterstützer „unterdrückter Gruppen“ zu positionieren, um politisch korrekt zu erscheinen. Andere ignorieren diese Themen und riskieren damit, als anti-progressiv eingestuft zu werden.
Dies führt zu einem Bewerbungsprozess, der weniger auf individuellen Leistungen und Fähigkeiten beruht, sondern stark politisch und kulturell geprägt ist. Aktuelle Studien bestätigen diesen Trend. So zeigt Forschung, dass ein großer Teil der Bewerber*innen aus Minderheiten ihre Essays gezielt nutzen, um über Rasse, ethnische oder sexuelle Identität zu schreiben, während es bei weißen Bewerbern deutlich seltener vorkommt. Diese Entwicklung verursacht soziale Spannungen und wirft ethische Fragen zur Fairness auf. Ist es gerecht, dass der Aufsatz in erster Linie zu einer Bühne für Minderheitenpolitik umfunktioniert wurde? Führt dies zu einer Benachteiligung anderer Bewerbergruppen und einer Verzerrung des Zulassungsprozesses? Die paradoxe Situation ist, dass ursprüngliche Absichten guter Chancengleichheit und Förderung unterschiedlicher Talente nun in einer verstärkten Politisierung des Zulassungsverfahrens gipfeln.
Anstelle von Leistung und individueller Eignung rücken Aspekte wie Zugehörigkeit und erlittene Benachteiligungen in den Vordergrund. Das bedeutet, dass der Bewerbungsprozess subjektiver und potenziell weniger meritokratisch wird. Die Personalität der Bewerbungsaufsätze droht von einer Formel beherrscht zu werden, die hauptsächlich nach politischen Kriterien bewertet wird. Viele Stimmen innerhalb der Wissenschaft und Bildungspolitik fordern daher eine grundlegende Reform. Eine radikale Option wäre, den Bewerbungsaufsatz komplett abzuschaffen, um die Auswahl stärker an objektiven Kriterien auszurichten.
Indem man alle Hinweise auf Identität, Herkunft oder Diskriminierung aus dem Zulassungsprozess entfernt, könnten Hochschulen eine neutralere und auf tatsächlichen akademischen und persönlichen Leistungen basierende Bewertung vornehmen. Einige Universitäten und politische Akteure plädieren gar für eine vollständige Anonymisierung von Bewerbungsunterlagen, bei der Namen, Wohnorte oder vorangegangene Bildungsstätten nicht mehr genannt werden dürfen, um sämtliche Formen von Bias auszuschließen. Auch der Einsatz digitaler Technologien wie Künstlicher Intelligenz, etwa ChatGPT, wirft neue Fragen auf. Der zunehmende Gebrauch von automatisierter Textgenerierung erschwert es immer mehr, authentische und persönlich verfasste Essays zu erkennen. In einem Umfeld, in dem der Bewerbungsaufsatz ohnehin kontrovers diskutiert wird, wird die Forderung nach dessen Abschaffung durch technologische Herausforderungen zusätzlich gestärkt.
Auf der anderen Seite gibt es Kritiker, die meinen, dass gerade persönliche Geschichten und die Berücksichtigung individueller Lebensumstände einen wichtigen Beitrag zu einer vielfältigen und lebendigen Hochschulgemeinschaft leisten. Die Betonung von Identität und sozialer Herkunft könne helfen, Barrieren abzubauen und Chancengerechtigkeit zu fördern. Dennoch bleibt die zentrale Frage, wie ein fairer Kompromiss gefunden werden kann, der weder Politisierung noch Leistungsschwächung fördert. Die aktuelle politische Entwicklung in den USA deutet darauf hin, dass konservative Kräfte verstärkt auf eine Rückkehr zu meritokratischen Prinzipien drängen. Diese Bewegung könnte neue Impulse für Reformen in der Hochschulzulassung geben, indem sie Pressure auf Universitäten und Aufsichtsbehörden ausübt, Auswahlverfahren zu standardisieren und von identitätspolitischen Kriterien zu lösen.
Erfolgreiche Reformen setzen jedoch nicht nur auf die Abschaffung einzelner Elemente, sondern auch auf eine tiefgreifende Diskussion über das Ziel und die Ausgestaltung von Zulassungsverfahren. Dabei sollten faire, transparente und auf überprüfbaren Leistungen basierende Kriterien im Mittelpunkt stehen. Im Idealfall werden Talente auf Grundlage ihres Potenzials und ihrer tatsächlichen Fähigkeiten bewertet, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Fazit ist, dass der persönliche Bewerbungsaufsatz im aktuellen System seine ursprüngliche Funktion weitgehend verloren hat. Statt als authentisches Ausdrucksmittel der Bewerber*innen dient er vor allem dazu, gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten zu signalisieren und dadurch Zulassungsvorteile zu erwirken.
Eine Reform des Zulassungsprozesses scheint daher nicht nur wünschenswert, sondern notwendig zu sein, um sowohl Fairness als auch akademische Exzellenz zu fördern. Nur so kann das Ziel erreicht werden, die besten Köpfe unabhängig von identitätsbezogenen Kriterien an Universitäten zu bringen und damit langfristig den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.