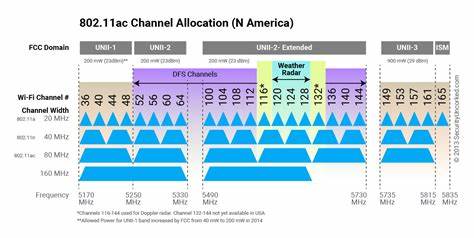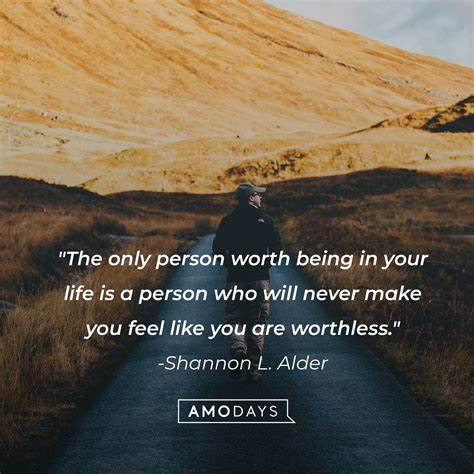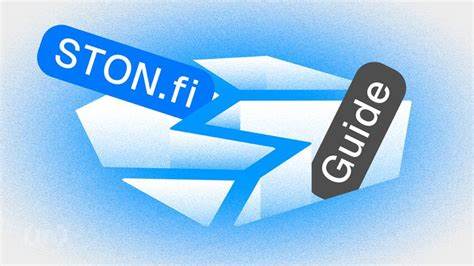Das US-amerikanische Hochschulsystem zeichnet sich durch komplexe Hierarchien und Dynamiken aus, welche entscheidend die Struktur und Entwicklung der akademischen Landschaft bestimmen. Die Einstellung sowie der Verbleib von Professor*innen beeinflussen nicht nur die Zusammensetzung von Lehre und Forschung, sondern auch die Verbreitung von Wissen, die Innovationskraft und die gesellschaftliche Teilhabe. Trotz vielfacher Diskussionen über Diversität und Chancengleichheit zeigt sich, dass das US-Professor*innen-Netzwerk tief verwurzelte Ungleichheiten und soziale Strukturen aufweist, die diesen Leitgedanken teils entgegenstehen. Eine wissenschaftliche Untersuchung aus dem Jahr 2022, die sich auf Daten von über 295.000 tenured oder tenure-track Fakultätsmitgliedern an 368 PhD-verleihenden Universitäten im Zeitraum von 2011 bis 2020 stützt, bietet hierzu wichtige Einblicke und Erkenntnisse.
Zentral ist die Erkenntnis, dass ein kleiner Kreis renommierter Universitäten die Mehrheit der Professor*innen ausbildet und auch maßgeblich die Verteilung akademischer Positionen bestimmt. Diese Institutionen, darunter unter anderem die University of California Berkeley, Harvard und Stanford, bilden eine Art akademischen Kern, dessen Absolvent*innen eine dominierende Rolle in der US-amerikanischen Hochschullandschaft einnehmen. Diese Konzentration ist über verschiedene Fachbereiche hinweg zu beobachten und weist auf eine ausgeprägte Ungleichheit in der Produktionskapazität akademischer Kompetenzen hin – eine Situation, die sich durch „soziale Abschottung“ und eine stabile Hierarchie noch verstärkt. Die Folgen dieser dominanten Stellung des Prestiges sind vielfältig. Studien zeigten bereits, dass Professor*innen von prestigeträchtigen Universitäten höhere Publikationsraten, mehr Ressourcen und größeren Einfluss auf wissenschaftliche Diskurse haben.
Bewerbungen von Angehörigen solcher Eliteinstitutionen genießen Vorteile bei Begutachtungsverfahren, und auch die spätere Karriereentwicklung beispielsweise in Form von Verdienststeigerungen fällt signifikant günstiger aus. Gleichzeitig zeigt sich, dass der typische akademische Karriereweg häufig einen Abstieg in der Hierarchie bedeutet – viele Professor*innen sind an einer Institution tätig, die niedriger im Prestige-Ranking steht als ihre eigene Doktorandenuniversität. Diese Dynamik deutet darauf hin, dass die Verbreitung von Ideen und akademischen Normen stark von diesem kleinen Kreis an Top-Universitäten gesteuert wird. Ein weiterer wesentlicher Faktor in der Beurteilung des US-amerikanischen Professor*innenmarktes ist der Gender-Aspekt, der in der Untersuchung ebenfalls eingehend analysiert wurde. Zwar sind Frauen in vielen Bereichen der Wissenschaft stark unterrepräsentiert, doch zeigen sich in den letzten zehn Jahren moderate Fortschritte.
Insbesondere in nicht-STEM-Bereichen wie der Bildung erhöhen sich die Frauenanteile stetig, während in Ingenieurs- und Naturwissenschaften das Wachstum nur langsam voranschreitet oder stagniert. Der Grund hierfür liegt vor allem darin, dass der Anteil weiblicher Neueinstellungen in der betrachteten Dekade weitgehend konstant blieb, die Erhöhung insgesamt also vor allem durch den altersbedingten Abgang männlicher Professor*innen zustande kam. Die Forschung legt nahe, dass ohne gezielte Maßnahmen in den Einstellungspraktiken langfristig mit keiner echten Gleichstellung zu rechnen ist. Ein oft diskutiertes Thema in akademischen Kreisen ist die sogenannte „Selbstanstellung“ oder „Academic inbreeding“, also die Beschäftigung von Absolvent*innen an der eigenen Ausbildungsstätte. In den USA liegt diese Quote bei rund neun Prozent, was im internationalen Vergleich noch relativ gering erscheint, aber tritt dennoch häufig auf und ist besonders an elitäreren Universitäten und in bestimmten Fachbereichen höher.
Überraschend ist, dass Selbstanstellungen häufig eine höhere Abbruchrate aufweisen, was Fragen über die Qualität und Nachhaltigkeit solcher Karrierewege aufwirft. Mögliche Ursachen für das Phänomen reichen von kulturellen Aspekten bis hin zu institutionellen Praktiken, deren Auswirkungen auf die akademische Vielfalt und den wissenschaftlichen Fortschritt weiter untersucht werden sollten. Ein kritischer Befund betrifft die Unterschiede in der Herkunft der Doktorgrade der Professor*innen. Circa elf Prozent der Fakultätsmitglieder haben ihre Promotion im Ausland erworben, wobei die meisten nicht-US-Absolvent*innen ihre Abschlüsse vor allem in England oder Kanada erlangten, während Regionen wie Afrika und Teile Amerikas deutlich unterrepräsentiert sind. Die Studie zeigt, dass Professor*innen mit Abschlüssen aus Ländern außerhalb von Kanada und Großbritannien im amerikanischen Hochschulsystem deutlich höhere Abbruchraten aufweisen als US- beziehungsweise kanadisch-britische Absolvent*innen.
Dies deutet auf eine mögliche strukturelle Benachteiligung oder Herausforderungen bei der langfristigen Integration und Karriereentwicklung hin, was weitergehender Forschungsarbeit bedarf. Insgesamt illustriert die Analyse ein Bild des US-akademischen Hochschulmarktes geprägt von extremen Ungleichheiten, einer festen Prestige-Hierarchie und sozialen Dynamiken, die Fortschritte in Bezug auf Diversität, Gleichstellung und internationale Integration begrenzen. Die Dominanz weniger Universitäten schafft Barrieren für Bewerber*innen von „peripheren“ oder weniger angesehenen Instituten, während gleichzeitig bestehende Strukturen durch Attrition verstärkt werden. Die entworfenen Prestige-Netzwerke und mathematischen Modelle bieten konkrete Anhaltspunkte, wie diese Prozesse empirisch gemessen und visualisiert werden können. Die Erforschung solcher systemischer Aspekte hat weitreichende Konsequenzen über die akademische Landschaft hinaus.
Erkenntnisse über die Mechanismen von Einstellungen und Wegfall von Professor*innen können politische Maßnahmen informieren, die darauf abzielen, das akademische Umfeld gerechter und produktiver zu gestalten. Insbesondere gilt es fördernde Rahmenbedingungen zu schaffen, die Frauen, internationale Wissenschaftler*innen sowie Graduierte von weniger privilegierten Institutionen besser unterstützen. Ebenso sollte die Akademie reflektieren, wie Selbstanstellung und Prestige-Dynamiken die Offenheit und Innovationsfähigkeit des Wissenschaftssystems beeinflussen. Schlussendlich zeigt die Studie, dass CO2-klingende Prestige-Hierarchien und ungleiche Produktionsstrukturen im amerikanischen Hochschulwesen tief verankert sind und sich im Laufe der Jahre stabil gehalten haben. Um nachhaltig Veränderungen anzustoßen, sind daher nicht nur Einzelinitiativen, sondern systemweite Überlegungen und Reformen erforderlich.
Nur so lässt sich Lehre und Forschung diversifizieren, der wissenschaftliche Fortschritt beschleunigen und die akademische Community für die Herausforderungen der Zukunft stärken.