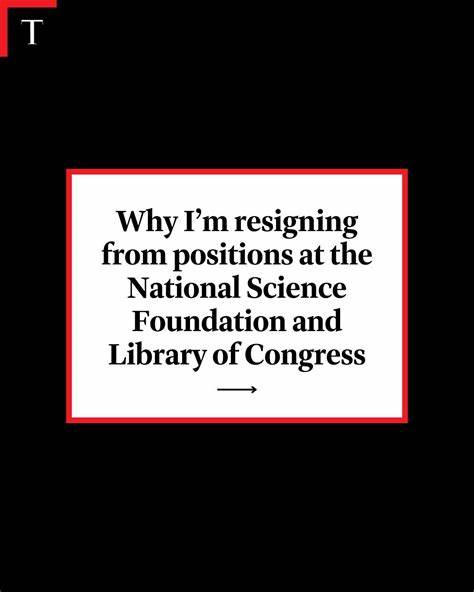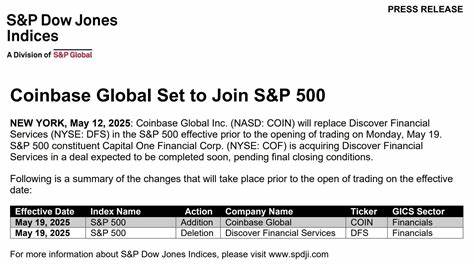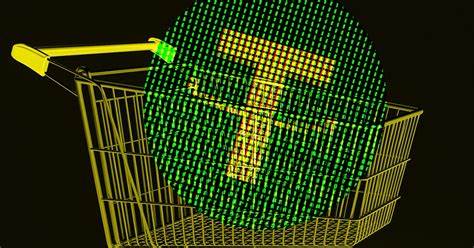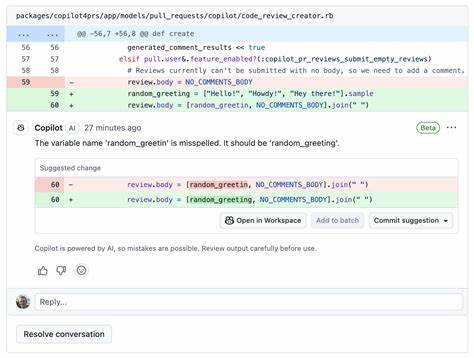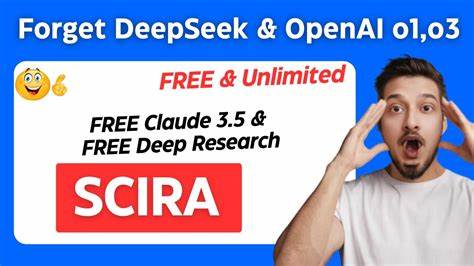Die National Science Foundation (NSF) gilt als eine der wichtigsten Institutionen in den Vereinigten Staaten, wenn es darum geht, wissenschaftliche Forschung zu fördern und Innovationen voranzutreiben. Seit ihrer Gründung im Jahr 1950 hat sie einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung von Technologien wie GPS und dem Internet geleistet. Doch trotz dieses herausragenden Erbes stehen die NSF und verwandte Institutionen wie die Library of Congress aktuell vor immensen Herausforderungen, die nicht nur ihre Unabhängigkeit, sondern auch die demokratischen Grundpfeiler ihrer Arbeit infrage stellen. Ein jüngst veröffentlichter Rücktritt aus der National Science Board und der Scholars Council der Library of Congress wirft ein Schlaglicht auf diese bedrohlichen Entwicklungen und bietet Einblicke in die politischen Dynamiken, die die Freiheit der Forschung und Wissensvermittlung zunehmend einschränken. Die Beweggründe, die zu diesem Schritt führten, entstammen einer wachsenden Frustration über die schleichende Erosion institutionaliserter Integrität und demokratischer Beratungsprozesse.
Die NSF war einst ein leuchtendes Beispiel dafür, wie unabhängige staatliche Förderung Wissenschaft und Innovation unabhängig von politischen Zwängen unterstützen kann. Doch die Realität heute sieht anders aus. Das ehemals beratende National Science Board wurde zunehmend zu einer zahnlosen Institution, deren Einfluss marginalisiert und deren Sitzungen eine reine Inszenierung geworden sind. Die Möglichkeit, wirklich ehrlich und konstruktiv zu beraten, wurde durch interne Machtverschiebungen und politische Einflussnahmen systematisch untergraben. Diese Verschiebung zeigte sich exemplarisch während interner Besprechungen, in denen offenbar ein Mitglied des sogenannten DOGE-Teams per Zoom an Sitzungen teilnahm und zeitgleich wenig Interesse an den Diskussionen zeigte.
Noch besorgniserregender war die Tatsache, dass von solchen Akteuren die Möglichkeit eingeräumt wurde, bereits von Experten geprüfte Förderanträge zu blockieren, ohne weitere fachliche Prüfung. Ein solcher Machtmissbrauch verrät nicht nur das Vertrauen in die wissenschaftliche Begutachtung, sondern gefährdet auch das Prinzip der freien und unabhängigen Forschung als Motor gesellschaftlichen Fortschritts. Darüber hinaus zeigt sich hinter diesen Entscheidungen eine besorgniserregende Tendenz hin zu autoritären Ansätzen bei der Steuerung von Wissen und akademischer Freiheit. Diese Entwicklungen widersprechen dem ursprünglichen Gründungsprinzip der NSF sowie dem Geist der Aufklärung, die auf offenen Dialog und demokratische Teilhabe setzt. Stattdessen droht eine schleichende Normalisierung eines Systems, in dem die Legitimation von Institutionen zwar formal bestehen bleibt, ihre tatsächliche Wirksamkeit jedoch strategisch untergraben wird.
Parallel zu den Veränderungen bei der NSF erlebt auch die Library of Congress demokratischen Verfall. Die Entlassung der Bibliothekarin Dr. Carla Hayden ist ein drastisches Signal dieser Entwicklung und steht beispielhaft für die politische Einflussnahme auf kulturelle und wissensvermittelnde Institutionen. Als erste afroamerikanische und erste Frau in dieser Position war Dr. Hayden eine engagierte Verfechterin der Digitalisierung von Bibliotheken und der Öffnung dieser für alle Bürgerinnen und Bürger.
Ihre Absetzung erfolgte unter Vorwürfen, die auf ihre Förderung von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion basierten sowie auf angeblich „unangemessenen“ Büchern für Kinder, was faktisch nicht zutrifft. Dieses Muster erinnert an systematische Kampagnen gegen öffentliches Engagement von Frauen und Minderheiten in der Bundesverwaltung. Auch der Rücktritt von Shira Perlmutter, der Register der Copyrights, verdeutlicht die politischen Spannungen im Umgang mit aktuellen Fragen der Urheberrechte, insbesondere im Kontext von Künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf das geistige Eigentum. Diese Vorgänge illustrieren die umfassender werdende Auseinandersetzung darüber, wer Kontrolle über die Verbreitung und Kuratierung von Wissen und Informationen in der digitalen Ära ausübt. Was bedeuten diese Entwicklungen für die Zukunft der Wissenschaft und öffentlichen Wissensinfrastrukturen? Das schrittweise Aushöhlen unabhängiger Gremien und die Zunahme politischer Kontrollmechanismen haben weitreichende Folgen.
Sie beeinträchtigen nicht nur, welche Forschungsfragen gestellt und welche Daten gesammelt werden, sondern sie lenken auch die Perspektiven und Narrativen, die zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen herangezogen werden. Die grundsätzlich demokratische Aufgabe dieser Institutionen wird dadurch gefährdet – mit Konsequenzen, die über akademische Kreise hinaus in sämtliche Bereiche der Gesellschaft reichen. Der Rücktritt aus solchen Positionen ist nicht einfach eine persönliche Entscheidung oder ein Akt der Resignation. Im Gegenteil, er stellt einen klaren Protest gegen Systeme dar, die Ehrlichkeit und offene Beratung unmöglich machen. Es ist ein bewusster Schritt, sich nicht an Prozessen zu beteiligen, die nicht mehr der ursprünglichen Mission dienen, sondern diese untergraben und verzerren.
Gleichzeitig soll dieser Schritt auch eine Ermutigung sein, die Bedeutung einer freien und offenen Wissenschafts- und Wissenspolitik wieder sichtbar zu machen. Der Rücktritt mahnt auch dazu, die Rolle der Sprache und Kommunikation im gesellschaftlichen Diskurs zu reflektieren. Sprache kann nicht nur Gewalt repräsentieren, sie wirkt selbst als Gewalt, wenn sie den Zugang zu Wissen einschränkt oder unterdrückt. Die sorgfältige Gestaltung von Worten und deren Wirkung ist zentral für die Debatte um demokratische Teilhabe und die Gestaltung von Wissenschaftspolitik. Das Halten an „falscher“ Sprache oder unreflektierter Kommunikation sorgt dafür, dass Erkenntnisse und kritische Stimmen im Keim erstickt werden.
Es ist daher essenziell, neue Wege des Ausdrucks zu finden, die Widerstand gegen diese Entwicklungen ermöglichen und den Austausch von Wissen öffnen. Die aktuelle Lage verdeutlicht auch den Wert von strategischem Widerstand. Exit, also der Bewusstseinsakt des Weggehens oder Rücktritts, ist zu verstehen als eine Form des lauten Protests, der zugleich Raum für neue Stimmen schafft. Es ist nicht die Aufgabe von engagierten Fachleuten, untätig hinzunehmen, wie sich Institutionen von innen heraus aushöhlen lassen. Vielmehr liegt darin auch eine Botschaft der Hoffnung, dass Loyalität nicht im blinden Verbleib besteht, sondern in der kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung mit der institutionellen Realität.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Zukunft unabhängiger Wissenschaftsförderung und der freien Wissensvermittlung auf dem Spiel steht. Institutionen wie die NSF und die Library of Congress haben in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen, den amerikanischen wie globalen Wissensstand voranzutreiben und demokratische Werte zu sichern. Der jüngste Rücktritt ist ein Weckruf, der deutlich macht, dass es notwendig ist, gegen politisch motivierte Einschränkungen und autoritäre Tendenzen im Umgang mit Wissen aufzustehen und für eine transparente, inklusive und freie Wissenschaftseinfrastruktur einzutreten. Nur so kann gewährleistet werden, dass Forschung, Kultur und Bildung auch künftig als Motoren gesellschaftlichen Fortschritts und demokratischer Teilhabe fungieren.