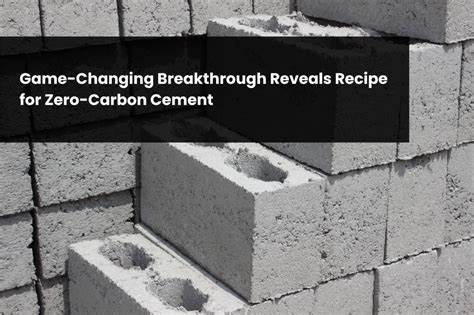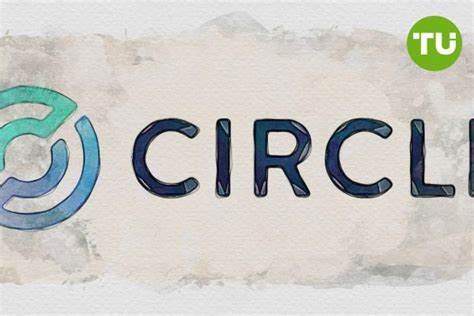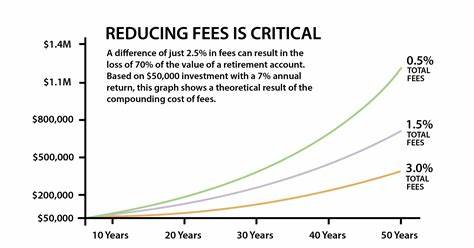Die Betonherstellung zählt zu den größten Herausforderungen im Kampf gegen den Klimawandel, denn sie verursacht etwa acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Baustoffen und dem dringenden Ziel, Treibhausgasemissionen zu senken, ist die Suche nach umweltfreundlicheren Alternativen zur konventionellen Zementproduktion von herausragender Bedeutung. Ein Forschungsteam der Universität Cambridge hat nun eine revolutionäre Methode vorgestellt, die die Herstellung von klimaneutralem Zement ermöglichen könnte und dabei zugleich Recycling von Altbeton und Stahlproduktion kombiniert. Dieses Verfahren birgt das Potenzial, die Baustoffindustrie grundlegend zu transformieren und einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Bauwirtschaft zu gehen.Die neue Technologie basiert auf der Idee, alten Beton direkt in Elektroofen zu geben, die sonst für das Recycling von Stahl genutzt werden.
Bisher war es technisch schwierig, Beton wieder in einen nutzbaren Ausgangsstoff für neue Baumaßnahmen umzuwandeln. Altbeton enthält Sand, Steine und zementhaltige Bestandteile, die sich nicht ohne weiteres wiederverwerten lassen. Das Cambridge-Team um Professor Julian Allwood hat jedoch herausgefunden, dass durch das Erhitzen von zementhaltigem Beton in einem sogenannten Lichtbogenofen alte Bindemittel zurückgewonnen und erneut zu sogenanntem Klinker umgewandelt werden können. Klinker ist die Basis für Zement, ein Pulver, das mit Wasser gemischt Beton bildet.Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass es den für die Stahlproduktion nötigen Flussmaterialien ähnelt, die normalerweise Kalkstein enthalten.
In der neuen Methode ersetzt der recycelte Zement die traditionellen Zuschlagstoffe im Stahlprozess. Während die Stahlreinigung im Ofen effizient abläuft, entsteht als Nebeneffekt eine Schlacke, die schnell abgekühlt zu neuem Portlandzement wird. Dieses Material weist ähnliche Eigenschaften auf wie herkömmlicher Zement und kann uneingeschränkt in neuen Betonmischungen verwendet werden. Die Möglichkeit, beide Prozesse zu kombinieren, stellt einen innovativen Meilenstein dar, da sie Recycling und Rohstoffgewinnung synergetisch miteinander verbindet.Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt in der Energiequelle.
Elektroofen können mit erneuerbarer Energie betrieben werden, was die CO2-Emissionen im Vergleich zur herkömmlichen Zementherstellung drastisch reduziert. Die klassischen Methoden der Zementherstellung sind stark emissionsintensiv, da sie vor allem große Mengen an Kalkstein bei hohen Temperaturen zerlegen müssen, was chemisch gebundenes CO2 freisetzt. Die neue Methode vermeidet diesen Schritt weitgehend, da Recyclingmaterial eingesetzt wird und der Prozess mit Strom statt fossilen Brennstoffen funktioniert.Diese technologische Innovation wurde bereits erfolgreich im Pilotmaßstab getestet. Vom Laborversuch zu industriellen Produktionsmengen ist der Weg kurz, denn Oxford und andere renommierte Forschungseinrichtungen bestätigen das Potenzial.
Aktuell laufen größere Testreihen, bei denen in zwei Stunden etwa 66 Tonnen Zement hergestellt werden können. Das Forschungsteam ist überzeugt, dass sich die Produktion bis 2050 problemlos auf eine Milliarde Tonnen jährlich ausweiten lässt. Damit könnte ein substantieller Teil des weltweiten Zementbedarfs klimaneutral gedeckt werden.Neben den ökologischen Aspekten adressiert das Verfahren auch wirtschaftliche Herausforderungen. Die Herstellungskosten sollen sich im Vergleich zur konventionellen Produktion kaum erhöhen.
Das Zusammenlegen von Stahlrecycling und Zementherstellung spart Energie und Material sowie den teuren Abbau neuer Rohstoffe. Zudem reduziert sich der Bedarf an Deponieflächen für Bauabfälle erheblich, was lokale Umweltbelastungen mindert.Trotz der Chancen mahnt Professor Allwood zur Vorsicht. Die neue Technologie allein reicht nicht aus, um den CO2-Fußabdruck der Baubranche ausreichend zu verkleinern. Parallel muss auch der Verbrauch von Beton effizienter gestaltet werden.
Derzeit wird Beton weltweit im Übermaß verwendet, oft ohne dass bauliche Sicherheit gefährdet wird. Durch optimierte Planung, alternative Konstruktionsarten und besseres Materialmanagement könnte der Verbrauch deutlich verringert werden. Politische Rahmenbedingungen und Förderprogramme sind gefragt, um diese Transformation auf breiter Front umzusetzen.Auch Fragen zur Qualität und Langlebigkeit des neuen Zements werden derzeit intensiv untersucht. Die Materialeigenschaften müssen den hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Wetterbeständigkeit entsprechen, sodass Bauten langfristig sicher sind.
Erste Testergebnisse zeigen jedoch, dass der recyclte „Electric Cement“ den herkömmlichen Produkten weitgehend ebenbürtig sein kann.Neben den wissenschaftlichen Fortschritten stößt die Entwicklung auf gesellschaftliche Herausforderungen. Kritiker äußern Bedenken, ob die Energiewende im erforderlichen Umfang und Tempo umgesetzt wird, damit erneuerbare Energiequellen tatsächlich die Zementherstellung mit Strom versorgen. Andere bezweifeln, ob sich klimaneutrales Bauen wirtschaftlich durchsetzen kann oder ob der höhere Aufwand nicht durch Preiserhöhungen belastet wird. Die Forschenden sehen deshalb die Technik als Baustein eines umfassenden Wandels, der neben Innovation auch politische und gesellschaftliche Weichenstellungen benötigt.
Die Veröffentlichung der Forschung in der renommierten Fachzeitschrift Nature unterstreicht die Bedeutung der Entdeckung. Die Methode steht beispielhaft für die Möglichkeiten technischer Innovationen jenseits der reinen Energiebranche, um Klimaziele zu erreichen. Sie liefert konkrete Ansätze, um globale Großindustrien auf emissionsarme Prozesse umzurüsten. Erfolgreiche Skalierung und Akzeptanz könnten nicht nur die Zementproduktion revolutionieren, sondern auch Impulse für nachhaltige Rohstoffkreisläufe in anderen Bereichen geben.In Summe markiert das Cambridge-Verfahren einen wichtigen Schritt hin zu einer klimafreundlichen Baustoffwirtschaft.
Die Verbindung aus Elektroofen-Technologie, Recycling von Betonschlacke und stahlproduktionstechnischem Know-how schafft neue Synergien. Wenn erneuerbare Energien flächendeckend verfügbar sind und der Einsatz nachhaltiger Baumaterialien gefördert wird, kann diese Innovation zur wesentlichen Säule einer CO2-neutralen Baubranche werden. Die Zukunft des Bauens wird damit umweltverträglicher und ressourcenschonender – ein entscheidendes Signal für die globale Klimapolitik und Industrieentwicklung.