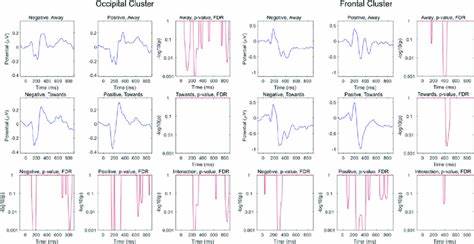In San Francisco sorgte die geplante Einführung eines sogenannten ‚Grading for Equity‘-Programms für erhebliches Aufsehen und breite Diskussionen in Bildungskreisen sowie unter Eltern und der Öffentlichkeit. Die Reform zielte darauf ab, ein gerechteres und weniger voreingenommenes Benotungssystem in den Schulen der Stadt einzuführen. Nach intensiven Kontroversen hat die Stadtverwaltung jedoch entschieden, den Plan vorerst nicht weiterzuverfolgen. Das Vorhaben, das unter anderem die Bewertung von Anwesenheit, Aufwand und Beteiligung im Unterricht abschaffen wollte, rief großen Widerstand hervor und ist ein Beleg für die komplexen Herausforderungen bei der Umsetzung von Bildungsinnovationen im Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeitsansprüchen und traditionellen Leistungsmaßstäben. Die Grundidee hinter dem ‚Grading for Equity‘-Modell bestand darin, die Benotung fairer und motivierender für Schülerinnen und Schüler zu gestalten.
Durch die Beschränkung der Notengebung auf summative Leistungen, also hauptsächlich Abschlussprüfungen, sollten subjektive Einflüsse wie Anwesenheit oder Engagement minimiert werden. Die Initiatoren argumentierten, dass eine solche Praxis die Noten genauer abbilden und insbesondere aufgrund von zuvor beobachteten Benachteiligungen historisch unterrepräsentierter Schülergruppen zu einer besseren Chancengleichheit führen könnte. Den Vorschlag präsentierte Superintendentin Maria Su während einer Sitzung des Schulvorstands von San Francisco Unified School District. Trotz der nur kurz gehaltenen Vorstellung hatte die Maßnahme weitreichende Konsequenzen. Ein Mitglied des Vorstands forderte detailliertere Informationen zu dem Programm, was zu einer intensiveren Debatte und schließlich zur Offenlegung des Vorhabens führte.
Obwohl das Projekt nicht unmittelbar einer Abstimmung unterzogen wurde, war eine Einführung für das kommende Schuljahr angedacht. Die geplanten Änderungen hätten die herkömmliche Notengebung grundlegend verändert. Zentraler Bestandteil war, dass künftig die gesamte Schülerbewertung ausschließlich auf Summative Assessments basieren sollte. Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Beteiligung und Anwesenheit sollten komplett aus der Notenberechnung ausgeschlossen werden. Zudem war vorgesehen, Schülern mehr Möglichkeiten für Nachprüfungen zu geben und das Bewertungssystem auf einer Skala von 0 bis 4 oder mit einer Mindestpunktzahl von 50 Prozent zu kalibrieren, um das Durchfallen zu reduzieren.
Diese Maßnahmen zielten darauf ab, bestehende Nachteile für bestimmte Gruppen abzumildern und die Zahl der mangelhaften Noten (D und F) spürbar zu verringern. Trotz dieser gut gemeinten Ansätze stießen die Pläne bei vielen Eltern, Lehrkräften und Bildungsexperten auf große Skepsis und Ablehnung. Ein wesentlicher Kritikpunkt war, dass solche Veränderungen die akademischen Standards absenken und dabei helfen könnten, Schwächen zu kaschieren, anstatt Schüler zu höherer Leistung zu motivieren. Insbesondere die Abschaffung der Bewertung von Unterrichtsbeteiligung und Hausaufgaben führte zu Befürchtungen, dass wichtige Lernprozesse und persönliche Anstrengungen nicht mehr wertgeschätzt würden. Kritiker warnten davor, dass die Schüler dadurch weniger Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen könnten.
Die öffentliche Debatte wurde auch durch politische Stimmen verstärkt, die die Reform als „Notenverwässerung“ brandmarkten. Kalifornische Politiker und Kommentatoren, darunter der Staatssenator Kevin Kiley, bezeichneten die geplante Änderung als radikalen Schritt, der letztlich dazu führen könnte, dass „Schüler einfach nicht mehr durchfallen“. Die Sorge, dass diese Maßnahmen im Ergebnis eher eine Verschleierung echter Defizite bewirken als die Qualität der Bildung verbessern, wurde breit diskutiert. Vor diesem Hintergrund verkündete Bürgermeister Daniel Lurie nur wenige Tage nach der Präsentation, dass das Vorhaben nicht umgesetzt werde. In einem öffentlichen Statement machte Lurie deutlich, dass die angestrebten Änderungen nicht dazu beitragen würden, die Schüler angemessen auf die Zukunft vorzubereiten.
Er betonte die Notwendigkeit, einen „besseren Weg“ zu finden, der langfristig die Qualität der Bildung sicherstelle und das Vertrauen der Gemeinschaft wiederherstelle. Superintendentin Maria Su erklärte daraufhin ebenfalls, dass der Vorschlag auf Eis gelegt werde, um Raum für intensivere Diskussionen mit Eltern, Lehrkräften und weiteren Interessengruppen zu schaffen. Man wolle keinen Schritt überstürzen, sondern sicherstellen, dass alle Beteiligten einbezogen werden und die Maßnahmen dem Wohl der Schülerinnen und Schüler dienen. Besonders im Fokus stünden der Haushaltsausgleich, die Stabilisierung der Bildungsinfrastruktur und der Wiederaufbau des Vertrauens in das Schulsystem. Der Fall San Francisco illustriert exemplarisch die Komplexität bei der Einführung von ‚Equity‘-Programmen im Bildungswesen.
Während das Ziel, Benotungsverzerrungen zu mindern und Bildungsungerechtigkeiten abzubauen, unbestritten von Bedeutung ist, zeigt das Beispiel auch, dass der Weg dahin sensibel, transparent und partizipativ gestaltet sein muss. Änderungen, die als Bruch mit traditionellen Bewertungssystemen empfunden werden, bergen hohe Konfliktpotenziale und bedürfen einer differenzierten Aufklärung und Einbindung aller Beteiligten. Die Aufmerksamkeit, die das San Francisco-Programm auf sich zog, löste auch eine landesweite Diskussion über die Güte und Effektivität verschiedener Notensysteme aus. Einige Experten schlagen vor, dass neben faireren Benotungsrichtlinien auch pädagogische Begleitmaßnahmen notwendig sind, um Schülerinnen und Schüler wirklich zu fördern. Hierzu zählen individualisierte Lernpläne, gezielte Unterstützung bei Schwächen und die Förderung von intrinsischer Motivation neben objektiven Leistungsbewertungen.