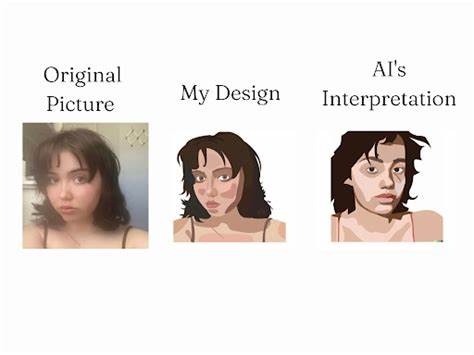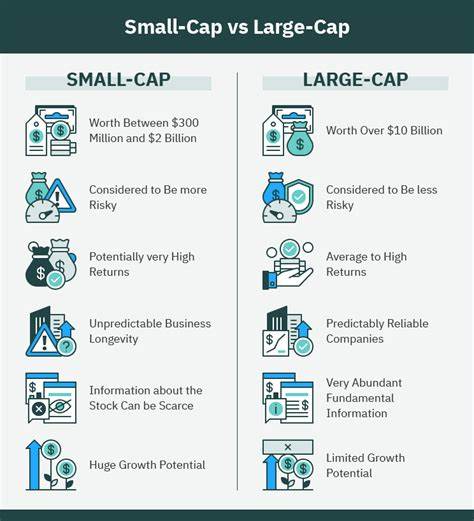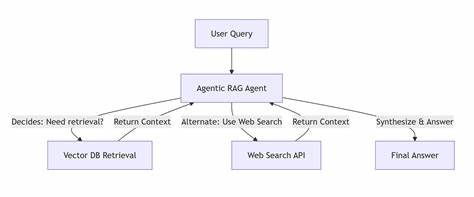Die Diskussion um Künstliche Intelligenz (KI) und speziell um große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) hat in den letzten Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Während einige die Technologie als bahnbrechenden Fortschritt feiern, äußern andere deutliche Skepsis oder sogar offene Ablehnung. Diese divergierenden Meinungen sind jedoch nicht allein auf oberflächliche Angst vor Neuem oder generelle Technophobie zurückzuführen. Vielmehr zeigt sich, dass unterschiedliche berufliche Hintergründe, Arbeitsweisen und Wertvorstellungen maßgeblich Einfluss auf die Einstellung gegenüber KI haben. Dieser Beitrag widmet sich deshalb der Frage: Wer genau hasst KI – oder ist zumindest skeptisch – und warum ist das so? Dabei sollen vor allem die technischen Perspektiven, die unterschätzen sozialen Dynamiken sowie die zugrundeliegenden Arbeitsstile erläutert werden, um ein umfassendes Verständnis der Debatte zu ermöglichen.
Zunächst einmal fällt auf, dass die Kritiker von KI häufig aus technischen Bereichen stammen, die sich durch eine hohe Kompositionsarbeit auszeichnen. Was ist damit gemeint? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich eine Einordnung der Tätigkeiten in sogenannte transformative und kompositionale Arbeit. Transformative Arbeit beschreibt die Tätigkeit, bei der aus rohem Material ein fertiges Produkt mit klarer Funktion geschaffen wird. Ein Beispiel dafür ist die klassische Anwendungsentwicklung: Aus Programmiersprachen, Algorithmen und Frameworks wird eine Software erschaffen, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt – der Fokus liegt hierbei vor allem auf dem Produkt selbst. Dagegen steht die kompositionale Arbeit, die sich dadurch auszeichnet, dass bereits vorhandene, in der Regel fertige Komponenten so zusammengefügt werden, dass ein funktionierendes Ganzes entsteht.
Diese Herangehensweise ist charakteristisch für Bereiche wie Systemadministration, Infrastrukturmanagement, UX/UI-Design oder DevOps. Hier zählt weniger die Erschaffung eines einzelnen neuen Artefakts, sondern das präzise Zusammenwirken vieler Teile. Die Herausforderung besteht darin, aus einem Katalog vorhandener Bausteine eine stimmige, sichere und zuverlässige Lösung zu komponieren. Präzision und Wahlfreiheit haben bei dieser Arbeit höchste Priorität. Interessanterweise lässt sich bei der KI-Debatte beobachten, dass Vertreter von kompositionaler Arbeit tendenziell skeptischer gegenüber LLM-Technologien sind.
Warum ist das so? LLMs sind von Natur aus schlecht darin, die Werte zu berücksichtigen, die bei kompositorischer Arbeit essenziell sind: Wahlfreiheit und Präzision. Die Wahlfreiheit bezieht sich darauf, dass in der Kompositionsarbeit stets eine bewusste Auswahl einer passenden Komponente getroffen werden muss. Beispielsweise entscheidet ein Datenbankadministrator je nach Anforderung zwischen PostgreSQL, Redis oder MongoDB – jede Lösung hat ihre eigenen Stärken und sollte zielgerichtet eingesetzt werden. KI-Modelle, basierend auf Wahrscheinlichkeiten statistischer Muster, liefern oft Durchschnittslösungen oder halluzinieren sogar passende Optionen, was in sicherheitsrelevanten oder hochpräzisen Umgebungen fatal sein kann. Ergänzend dazu steht die Präzision, die in kompositionalem Arbeiten unerlässlich ist.
Hier müssen Bauteile und Software genau aufeinander abgestimmt werden, alles muss verlässlich funktionieren und Produktionsprozesse dürfen keine unerwarteten Abweichungen aufweisen. LLMs können zwar brauchbare Entwürfe oder Vorschläge generieren, versagen aber oft bei der unveränderlichen Erfüllung von Anforderungen. Sie erzeugen häufig fehlerhafte oder unzuverlässige Inhalte, die in Produktionsumgebungen zu Sicherheitsproblemen, Ausfällen oder hohen Kosten führen können. Diese mangelnde Verlässlichkeit ist für Kompositionsfachleute ein rotes Tuch. Ganz anders sieht die Situation oft bei den Verfechtern von KI aus, die eher in der Anwendungsentwicklung angesiedelt sind, also transformative Arbeit leisten.
Für diese Gruppe sind LLMs wertvolle Hilfsmittel, die kreative Prozesse beschleunigen, Prototypen ermöglichen und Lösungen auf Basis von Vorlagen generieren können. Der Fokus liegt hier eher auf der Exploration verschiedener Möglichkeiten und weniger auf der präzisen Integration in ein bestehendes, komplexes System. Daher werden die Schwächen der KI bei Wahlfreiheit und Präzision oftmals als tolerierbar oder sekundär wahrgenommen. Diese grundsätzlichen Unterschiede führen zu einem Gegensatz in der Wahrnehmung von LLMs: Für transformative Fachbereiche sind diese Werkzeuge spannende Innovationsbeschleuniger, während sie im compositionalen Umfeld oft als unzuverlässige, ja schädliche Störquellen erscheinen. Man könnte sagen, die Technologie trifft auf zwei sehr verschiedenartige Arbeitswelten, die sich nur schwer miteinander versöhnen lassen.
Ein weiterer Faktor, der die Polarisierung verstärkt, ist die gesellschaftliche und wirtschaftliche Hervorhebung von Innovation, insbesondere von radikal neuen, disruptiven Entwicklungen. Silicon Valley und der Venture-Capital-Sektor feiern in erster Linie transformative Innovationen – also komplett neue Produkte und Geschäftsmodelle – und übersehen dabei die essenzielle Arbeit der Beharrlichkeit, Pflege und Integration bestehender Systeme. Diese Kompositionsleistungen, die oft stabilisierend und lebenswichtig sind, etwa in der Infrastruktur oder im öffentlichen Nahverkehr, erhalten kaum Aufmerksamkeit und werden finanziell und kulturell weniger gewürdigt. Dieser Fokus auf das Neue führt dazu, dass KI und insbesondere LLMs überproportional gehypt werden, obwohl sie in vielen praktischen Kontexten wenig tauglich sind. Die Marketingmaschinerie suggeriert, dass LLMs bald alle Bereiche revolutionieren und viele Jobs ersetzen könnten, was Ängste und Gegenreaktionen hervorruft.
Für die Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass Systeme stabil und sicher laufen, erscheint das als unreflektierter Aktionismus, der ihren Beitrag nicht wertschätzt und sogar untergräbt. Darüber hinaus führt der soziale Aspekt dazu, dass transformative, technologie-fokussierte Berufe oft männlich dominiert und gesellschaftlich als erstrebenswerter angesehen werden, während die eher weiblich geprägten Kompositionsberufe marginalisiert sind. Diese Einteilung verstärkt Vorurteile und verhindert eine ausgewogene Wertschätzung aller notwendigen Tätigkeiten im technischen Bereich. Die Degradierung der kompositorischen Arbeit zu „weniger innovativ“ oder gar „langweilig“ hat negative Konsequenzen für Vielfalt, Teamkultur und letztlich für die Qualität technischer Systeme. In technischer Hinsicht sind LLMs derzeit noch nicht in der Lage, eine tragfähige kompositionale Rolle einzunehmen.
Sie scheitern daran, komplexe Systeme mit vielen Abhängigkeiten konsistent zu berücksichtigen, sie generieren fehlerbehaftete Vorschläge und können keine sicheren, wiederholbaren Entscheidungen treffen, die für Infrastruktur oder sicherheitsrelevante Software unverzichtbar sind. Ihre Stärken liegen vielmehr in der schnellen Ideenfindung, dem Erzeugen von Texten und Code-Schnipseln und dem Explorieren von Lösungsansätzen in einem ungefährlichen Umfeld. Die Kommunikations- und Technologiebranche befindet sich aktuell in einer Phase, in der die Euphorie um KI die kritischen Stimmen oft übertönt. Die Skeptiker weisen jedoch darauf hin, dass ein zu unkritischer Umgang mit LLMs und deren Überbewertung zu ernsthaften Problemen führen kann, etwa zu Sicherheitslücken, steigenden Kosten durch Fehlkonfigurationen und einer Verschlechterung der Systemstabilität. Außerdem warnen sie davor, die komplexen Anforderungen von Infrastrukturen und gesellschaftlichen Systemen mit oberflächlichem Prototyping-Technologie zu substituieren.
Insgesamt zeigt sich, dass die Polarisierung in der Haltung zur KI weniger eine Frage von Technologiegläubigkeit oder Angst ist, sondern tief in unterschiedlichen Arbeitsweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftlichen Strukturen verwurzelt ist. Ein besseres Verständnis dieser Zusammenhänge kann helfen, den Diskurs versachlichter zu führen und zu Lösungen zu kommen, die sowohl transformative als auch kompositionale Bedürfnisse berücksichtigen. Wenn wir künftige Entwicklungen erfolgreicher gestalten wollen, ist es wichtig, die verschiedenen Arten von Arbeit anzuerkennen und zu respektieren. Kompositionale Arbeit darf nicht länger als zweitklassig betrachtet werden, sondern muss als Basis für nachhaltige technologische Innovation aufgefasst werden. Gleichzeitig sollten wir uns ehrlich mit den Grenzen von LLMs auseinandersetzen und deren Einsatz sorgfältig an den jeweiligen Anwendungsfall anpassen.
Die öffentliche und fachliche Debatte über den Nutzen und die Risiken von KI wird deshalb in den kommenden Jahren vor allem davon abhängen, wie gut wir lernen, die unterschiedlichen Perspektiven und Anforderungen zu verstehen und als gleichwertig zu akzeptieren. Nur dann wird es gelingen, die Chancen von KI gezielt zu nutzen, ohne die fundamentalen Grundlagen unserer technischen und gesellschaftlichen Systeme zu gefährden.