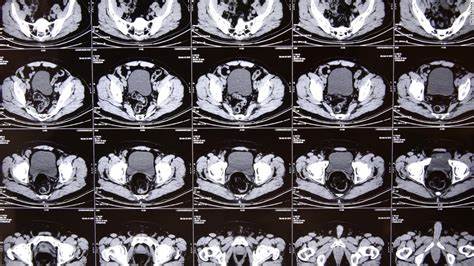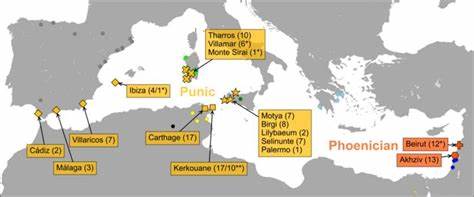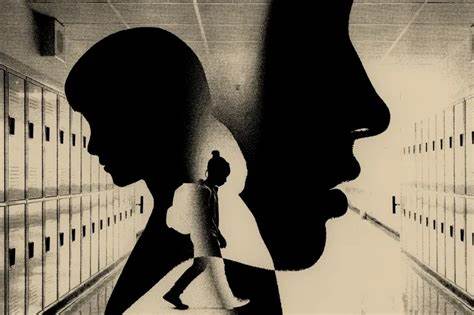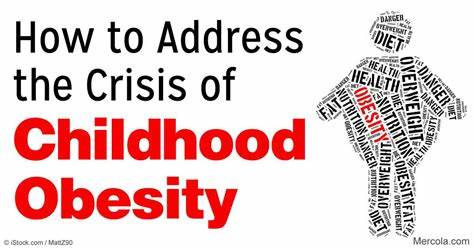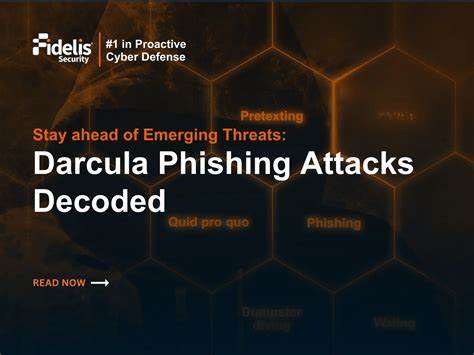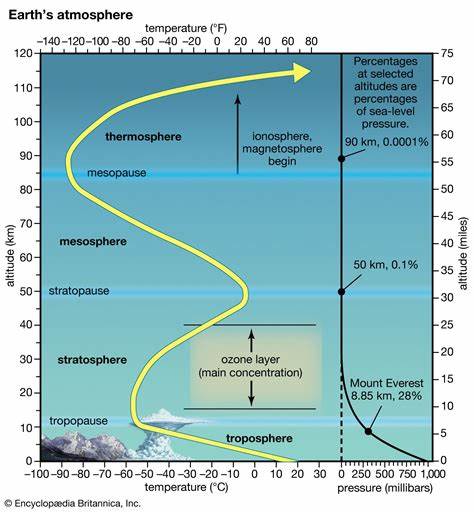Schlangenbisse stellen weltweit ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und verursachen jährlich Zehntausende Todesfälle sowie massiv bleibende Behinderungen. Gerade in tropischen Regionen und Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen sind Menschen besonders gefährdet, da dort eher wenig wirksame Antivenome zur Verfügung stehen. Die Vielfalt und Komplexität der Schlangengifte erschwert die Entwicklung universaler Gegengifte zusätzlich. Genau an diesem Punkt setzt eine ungewöhnliche Geschichte an, die Hoffnung auf eine vielversprechende Lösung macht. Ein Mann hat sich über Jahrzehnte hinweg mehr als 200 Mal bewusst von giftigen Schlangen beißen lassen, um durch die Entstehung einer umfassenden Immunität das menschliche Immunsystem als Schlüssel zur Entwicklung eines neuen, breiteren Antivenoms nutzbar zu machen.
Sein Name ist Tim Friede. Tim Friedes Faszination für Schlangen begann bereits in seiner Kindheit in Wisconsin, wo er mit ungiftigen Schlangen wie der Strumpfbandnatter in Berührung kam. Als Erwachsener entwickelte sich sein Interesse hin zu giftigen Arten wie Kobras, schwarzen Mambas oder Taipanen. Mehr als aus reinem Interesse trieb ihn der Wunsch, Menschen zu helfen, die durch Schlangenbisse gesundheitlich nachhaltig geschädigt werden. Die globale Bedrohung, die von Schlangenbissen ausgeht, ist enorm.
Die Weltgesundheitsorganisation berichtet von Zehntausenden Todesfällen pro Jahr und Hunderttausenden von Langzeitverletzungen, die oft zu Amputationen, langwierigen Operationen oder dauerhaften Funktionseinschränkungen führen. Das Venom von Schlangen ist eine äußerst komplexe Mischung aus Proteinen, Neurotoxinen, Gerinnungshemmern und anderen biologisch aktiven Stoffen. Diese wirken auf unterschiedlichste Weise auf den menschlichen Körper: einige lähmen die Atemmuskulatur, andere beeinflussen die Blutgerinnung, wiederum andere verursachen heftige Schmerzen oder massive Entzündungen ohne spürbare Schmerzen. Diese Vielfalt macht es bislang nahezu unmöglich, ein einzelnes Antivenom zu entwickeln, das gegen viele verschiedene Schlangenarten wirksam ist. Traditionell werden Antivenome durch die Verabreichung kleiner Venendosen an Pferde oder andere Tiere gewonnen, aus deren Blut dann Antikörper isoliert werden.
Dieses Verfahren ist zwar bewährt, aber aufwendig und spezialisiert auf einzelne Giftsorten. Während seiner zahlreichen Bissintervalle wurde Friede nach einem riskanten Start, bei dem er mehrere Tage im Koma verbrachte, allmählich vorsichtiger und lernte, mit seinem Körper umzugehen. Dabei entwickelte er ein Immun-Gedächtnis, das über Jahrzehnte hinweg Antikörper gegen viele verschiedene Arten von Schlangengiften generiert hat. Diese bemerkenswerte Eigenschaft trat ins Zentrum wissenschaftlicher Untersuchungen, als er auf den Biotech-Unternehmer Jacob Glanville traf, Gründer von Centivax. Glanville hatte die Vision eines universellen Antivenoms, inspiriert von seiner Arbeit an universellen Grippeimpfstoffen.
Er suchte nach einem gemeinsamen molekularen Muster in den verschiedenen Giftstoffen, das durch einen einzigen Antikörper abgefangen werden kann. Weil bei Tieren hergestellte Antikörper bisher nur limitiert wirksam waren, dachte er an menschliche Antikörper, die aus dem Immunsystem eines Menschen mit enormer Vielseitigkeit stammen. So fand er in Friede die perfekte Quelle für diese breit wirksamen Antikörper. Die Analyse von Friedes Blut hat zur Isolierung sogenannter „ultrabreiter“ menschlicher Antikörper geführt, die gleich mehrere Neurotoxine verschiedener Schlangenarten neutralisieren können. In Versuchen an Mäusen boten diese Antikörper vollständigen Schutz gegen gefährliche Arten wie den schwarzen Mamba sowie mehrere Kobra-Arten.
Um die Wirksamkeit zusätzlich zu erhöhen, ergänzte das Forschungsteam die Antikörper um ein kleines Molekül namens Varespladib, das bereits vorher bei bestimmten Schlangengiften Erfolge gezeigt hatte. Auch ein weiterer breitwirksamer Antikörper aus Friedes Blut wurde in die Mischung eingearbeitet. Das Ergebnis war ein Antidot-Cocktail, der nicht nur gegen 13 verschiedene Schlangenarten vollständigen Schutz bot, sondern auch bei weiteren sechs Arten eine teilweise Neutralisation zeigte. Die gedeckte Palette umfasst damit Schlangen aus unterschiedlichen Regionen der Welt: Asien, Afrika, Australien, Nordamerika und andere. Diese Kombination aus synthetischen Antikörpern und kleinen Molekülen stellt einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen die Vielfalt der Schlangengifte dar.
Wissenschaftler wie Stuart Ainsworth oder David Williams, Experten auf dem Gebiet von Schlangengiften und Antivenomen, sehen in diesem Ansatz einen wichtigen Schritt in Richtung eines universellen Antivenoms, auch wenn noch Herausforderung en bei der Erweiterung des Wirkbereichs auf Viperengifte und bei der klinischen Erprobung vor ihnen liegen. Die Tatsache, dass „nur“ bestimmte Giftkomponenten neutralisiert werden, wirft Fragen auf, wie die verbliebenen Toxine wirken und ob weitere Komponenten in das Cockta il aufgenommen werden müssen. Dennoch sind die Befunde überzeugend und geben Anlass zur Hoffnung. Die nächste Entwicklungsphase wird klinische Studien umfassen, unter anderem Tests an Hunden, die in Australien von giftigen Schlangen gebissen wurden. Langfristig ist geplant, das Antivenom für weitere Schlangenarten, insbesondere Vipern, zu erweitern.
Die Produktion soll so gestaltet werden, dass das Mittel weltweit bezahlbar und breit verfügbar ist. Der Markt für Antivenome wird auf rund 600 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt, allerdings ist er derzeit stark fragmentiert. Ein universelles Produkt könnte die Versorgung effizienter und günstiger machen. Für Tim Friede hat dieses Projekt eine tiefere Bedeutung: Es ist sein persönlicher Beitrag zur Heilung und Rettung von Menschenleben. Obwohl er mittlerweile mehrere Jahre kein Gift mehr zu sich genommen hat, prägt seine Erfahrung nach wie vor seinen Alltag und seine Vision für die Zukunft.
Seine Bereitschaft, sich über Jahre hinweg immer wieder giftigen Schlangen auszusetzen, war außergewöhnlich und ermöglichte diese medizinische Innovation. Die Geschichte von Tim Friede zeigt eindrucksvoll, wie außergewöhnliche individuelle Entscheidungen und wissenschaftliche Neugier kombiniert zu lebensrettenden Entwicklungen führen können. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, globale Gesundheitsprobleme mit kreativen Ansätzen und interdisziplinärer Zusammenarbeit anzugehen. Durch diese Forschung rückt ein universales Antivenom für die lebensbedrohlichen und komplexen Wirkungen von Schlangengiften greifbar näher – ein Meilenstein, der viele Leben retten könnte, vor allem in Regionen, die am stärksten von Schlangenbissen betroffen sind.