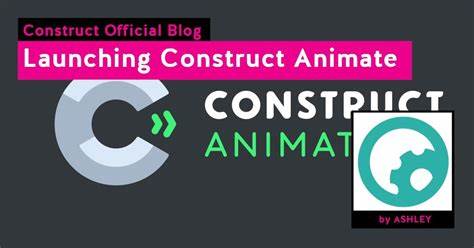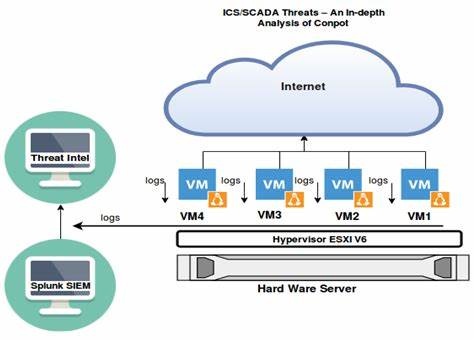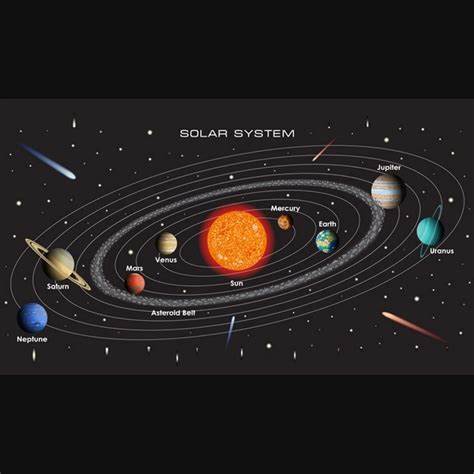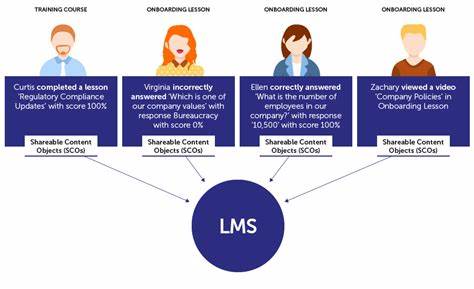Apple gehört zu den bekanntesten und wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch der Ruf von Apple als innovativer Technologieriese steht seit einigen Jahren unter Beobachtung. War das Unternehmen einst das Symbol für kreative Brillanz und bahnbrechende Innovationen, so wirkt es heute vielerorts wie eine Maschine zur Maximierung von Gewinnen. Die Metapher der „Apple Turntable“ – zu Deutsch etwa „Apple Plattenteller“ – beschreibt die Vorstellung davon, dass Apple sich wie eine zerkratzte Schallplatte wiederholt, immer dieselben Melodien spielt und sich nicht mehr wandelt. Die Frage ist, wie es dazu kam und ob Apple sich jemals wieder von diesem Muster lösen kann.
Der Ursprung von Apple ist eng verbunden mit zwei einzigartigen Persönlichkeiten: Steve Jobs und Steve Wozniak. Sie gründeten Apple zu einer Zeit, in der Unternehmensgründungen und Innovationen anders abliefen als heute. Interessant ist, dass beide keine klassischen Geschäftsleute waren. Stattdessen lebten sie das Prinzip „Think Different“, mit dem Apple einst nicht nur geworben, sondern gelebt hat. Steve Wozniak, der brillante Ingenieur, brachte die technischen Fähigkeiten mit, die Apple zum Leben erweckten.
Steve Jobs war kein ausgebildeter Ingenieur oder Designer, vielmehr ein visionärer Technologieenthusiast mit einer außergewöhnlichen Gabe, Produkte und Märkte zu verstehen und zu gestalten. Das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Talente war es, das Apple in den Anfangsjahren antreiben konnte. Dass Steve Jobs und Wozniak keine MBA-Absolventen waren, ist keine Kleinigkeit. Es zeigt, dass das Unternehmen von den Gründungsjahren an anders geführt wurde als viele andere Technologiekonzerne, die eher von klassisch ausgebildeten Wirtschaftsführern geleitet werden. Dieses Ungleichgewicht zwischen Ingenieurskunst und Management-Denken schuf Raum für radikale Innovationen, die aus Leidenschaft und der Liebe zum Produkt entstanden.
Doch mit dem Schritt an die Börse 1980 verlor dieses ursprüngliche Führungsteam die Kontrolle über das Unternehmen. Der Börsengang veränderte die Dynamik bei Apple grundlegend. Als öffentliches Unternehmen ist Apple heute vor allem verpflichtet, den Erwartungen der Investoren gerecht zu werden, die häufig keine langen Zeithorizonte für Innovation haben, sondern auf kurzfristige Renditen setzen. Anders als Gründer wie Mark Zuckerberg, die sich spezielle Aktienklassen schufen, um ihre Führung auch mit Minderheitsbeteiligungen zu sichern, verzichteten Jobs und Wozniak auf solche Kontrolle. Die Konsequenz war, dass sie im Konflikt mit dem damaligen Apple-CEO John Sculley 1985 das Unternehmen verlassen mussten.
Das Silicon Valley kannte solche Dramen, doch die Situation bei Apple führte zu einer Phase der Stagnation und Produktfehler. Steve Jobs kehrte erst 1997 als CEO zurück, nachdem Apple in eine finanzielle Krise gerutscht war. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, ein modernes Betriebssystem als Nachfolger für den klassischen Macintosh zu entwickeln. Apples Vorstand stand vor der Wahl, entweder BeOS von Jean-Louis Gassée oder NeXTSTEP von Jobs zu kaufen. Die Wahl fiel letztlich auf NeXTSTEP, was Jobs zurück nach Apple brachte – aber nicht ohne Vorbehalte.
Jobs verkaufte nahezu alle Apple-Aktien, die er beim Erwerb erhielt, da er wenig Vertrauen in die Führung hatte. Dieser Verkauf war ein schwerer Fehler für Jobs selbst, der dadurch viel Geld verlor. Doch als das Unternehmen in der Krise steckte, konnte Jobs vor allem durch einen klaren Finanzplan und eine straffe Führung überzeugen. Die Aktionäre, denen nichts anderes als Profit wichtig war, gaben ihm eine Chance. Jobs nutzte diese und erreichte eine spektakuläre Wende, die Apple aus der Insolvenz zu einem Wert von über einer Billion US-Dollar führte.
Der Glaube, dass Apple unter Jobs von einer inneren Pflicht geleitet wurde, „einen Abdruck im Universum zu hinterlassen“ und nicht nur Geld zu machen, ist weit verbreitet. Doch eine genaue Betrachtung zeigt, dass selbst Jobs kaum Chancen hatte, wenn die finanziellen Grundlagen nicht stimmten. Letztendlich mussten Renditen erzielt werden, um seine Position zu sichern. Der Unterschied zu späteren CEOs besteht darin, dass Jobs Innovationen und Kundenerlebnisse konsequent über reine Gewinnmaximierung stellte, auch wenn dies kurzfristige Risiken bedeutete. Seit Tim Cook 2011 die Führung übernahm, hat Apple eine andere Richtung eingeschlagen.
Zwar blieb Apple ein erfolgreiches Unternehmen, aber der Fokus liegt seither deutlich stärker auf der Optimierung von Profiten als auf unkonventioneller Innovation. Apple unter Cook hat das Geschäft mit Dienstleistungen wie dem App Store, iCloud oder Apple Music massiv ausgebaut. Diese sogenannten „Services“ bringen stabile Einnahmen und sind für Investoren äußerst attraktiv. Doch sie verändern auch das Bild von Apple. Kunden und Entwickler beklagen die restriktive Kontrolle, etwa bei der App Store-Gebühr, und die zurückgehende Innovationskraft außerhalb der bestehenden Produktlinien.
Der Erhalt der Profitfähigkeit ist für die Aktieninhaber und großen Investoren entscheidend. Investoren wie Warren Buffett mit Berkshire Hathaway oder institutionelle Großaktionäre wie Vanguard, BlackRock und State Street geben das Tempo und die Richtung vor. Diese Investoren verfolgen primär finanzielle Ziele und haben kein Interesse daran, dass Apple seine Strategie auf radikale Innovation oder gar Risikoorientierung ändert. Ein CEO, der profitmaximierend handelt, wird dementsprechend favorisiert. Tim Cook hat sich damit als einer der erfolgreichsten Manager in der Geschichte Apples etabliert, wenn man die reine Kapitalrendite betrachtet.
Trotz all dieser Erfolge wird Apple oft als „Plattenteller“ beschrieben – ein Bild vom Unternehmen, das immer dieselben Melodien abspielt und sich dreht, ohne neu aufzulegen oder sich zu verändern. Die besondere Unternehmenskultur, die Jobs begründet hatte, scheint durch die Interessen der Investoren verdrängt worden zu sein. Die wenigen Führungskräfte aus der Jobs-Ära, wie Phil Schiller, sehen sich inzwischen durch Tim Cook marginalisiert. Interne Stimmen, die auf Abmilderung der Profitforderungen drängen, werden ignoriert, wie es unter anderem im much-beachteten Epic Games Rechtsstreit sichtbar wurde. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob Apple jemals eine „Renaissance“ erleben kann, bei der die Innovationskraft wieder in den Vordergrund rückt.
Die momentane Eigentümerstruktur scheint das aber auszuschließen. Ein CEO, dessen primäre Aufgabe es nicht ist, Profite zu maximieren, sondern kulturelle Identität oder langfristige Vision zu fördern, findet kaum Support in der heutigen Kapitalmarktordnung. Die Unternehmenskultur, die einst von einem technologiebegeisterten Visionär geprägt wurde, ist gewandelt und orientiert sich nunmehr an den Vorgaben der Börse. Es ist ungewiss, ob Apple je zu seinen Wurzeln zurückkehren kann oder ob das Unternehmen auf Dauer lediglich als hochprofitables, aber wenig liebenswertes Konzerngigant bestehen wird. Während Nutzer und Entwickler Apple noch aus Nostalgie oder praktischen Erwägungen die Treue halten, zeigt sich in vielen Bereichen, dass die Innovationsdynamik abgenommen hat.