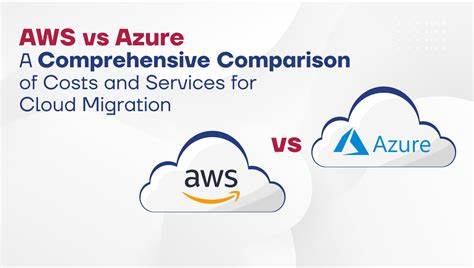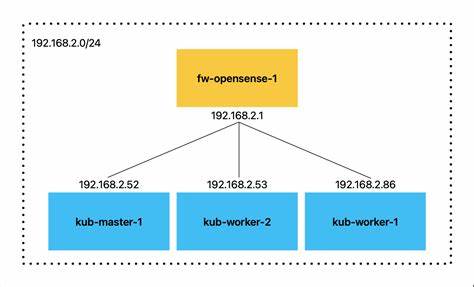Die Diskussion um die Legalisierung von Cannabis gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung. Länder und Regionen wägen sorgfältig ab, ob und wie regulierter legaler Zugang zu Cannabis die öffentliche Gesundheit und das Konsumverhalten beeinflusst. Eine aktuelle, wegweisende Studie aus der Schweiz setzt neue Maßstäbe, indem sie erstmals kausale Zusammenhänge zwischen legalem Zugang und problematischem Kiffen aufzeigt. Im Gegensatz zu früheren Beobachtungsstudien liefern die Forschenden aus Basel, die eine randomisierte kontrollierte Studie durchführten, robuste Belege dafür, dass eine Legalisierung unter kontrollierten Bedingungen sogar zu einem Rückgang von missbräuchlichem Konsum führen kann. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für die Schweiz von Relevanz, sondern bieten wichtige Anhaltspunkte für nationale und internationale Regulierungsdebatten.
Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Addiction veröffentlicht und untersuchte 378 erwachsene regelmäßige Cannabiskonsument*innen aus dem Kanton Basel-Stadt. Die Teilnehmer*innen wurden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt: Die eine erhielt legalen Zugang zu Cannabis über neun Apotheken, während die Kontrollgruppe weiterhin illegal beschaffte Cannabismittel konsumierte. Dabei zeichnete sich die legale Versorgung durch strenge Qualitätskontrollen, beschränkte THC-Gehalte, THC-abhängige Preismodelle sowie Zugang zu Beratung und aufklärenden Materialien aus. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurden die Konsument*innen mittels Onlinebefragungen zu ihrem Cannabiskonsum, psychischen Befinden und weiteren Aspekten begleitet. Das zentrale Ergebnis der Studie lag in der Messung des problematischen Konsums mithilfe des Cannabis Use Disorders Identification Test-Revised (CUDIT-R), einem validierten Selbstauskunftsinstrument.
Zu Beginn erzielten die Teilnehmenden beider Gruppen einen Durchschnittswert von etwa 11 – ein Wert, der auf problematischen Gebrauch hinweist. Nach sechs Monaten zeigte sich bei den legal versorgten Nutzer*innen ein Rückgang auf durchschnittlich 10,1, während die Kontrollgruppe lediglich auf 10,9 sank. Auch wenn das Ergebnis knapp an der statistischen Signifikanzgrenze lag (p = 0,052), war die Tendenz in verschiedenen Analysen konsistent und aufschlussreich. Besonders bemerkenswert war die Analyse der Teilnehmenden, die neben Cannabis weitere Drogen konsumierten. Diese Gruppe profitierte deutlich mehr vom legalen Zugang: Die CUDIT-R-Werte sanken hier um fast zwei Punkte, was gemäß Expertenmeinung eine bedeutsame Verhaltensänderung bedeutet.
Im Gegensatz dazu zeigte sich bei Cannabis-Alleinkonsument*innen kein relevanter Unterschied zwischen legalem und illegalem Zugang. Die sekundären Messgrößen, darunter Symptome von Depression, Angst und Psychose sowie Mengen des Konsums von Cannabis, Alkohol und anderen Drogen, wiesen keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen auf. Sowohl legal als auch illegal versorgte Personen berichteten nach sechs Monaten vergleichbarer psychischer Befindlichkeit und eines ähnlichen Cannabisverbrauchs. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Legalisierung vor allem ein Mittel zur Reduktion problematischer Verhaltensmuster sein kann, ohne zwangsläufig den Gesamtverbrauch zu erhöhen. Ein weiterer interessanter Befund war, dass etwa die Hälfte der legal versorgten Teilnehmenden weiterhin Cannabis illegal bezogen.
Dieses Phänomen, als „Crossover“ bezeichnet, schmälerte zwar die Reinheit des experimentellen Designs, veränderte aber nicht die Hauptergebnisse bei Ausschluss dieser Personen. Die Forscher*innen vermuten, dass die Kombination aus regulierter Qualität, Preisanreizen und begleitendem Beratungsangebot insbesondere für komplexere Nutzerprofile einen Nutzen darstellt. Obwohl die formale Beratung freiwillig war, bestand ein regelmäßiger Kontakt mit geschultem Apothekenpersonal, was insbesondere bei Personen mit Mehrfachkonsum einen positiven Einfluss gehabt haben dürfte. Auch zentrale Sorgen in der öffentlichen Debatte, wonach eine Legalisierung die psychische Gesundheit hätte verschlechtern oder zu vermehrten negativen Ereignissen führen könnten, fanden keinen Nachweis. Jeweils nur wenige ernsthafte Zwischenfälle traten auf, verteilt auf beide Gruppen, ohne Kausalität zugunsten der legalen Cannabisprodukte.
Die Studie hat jedoch wichtige Limitationen. Die Stichprobe war vergleichsweise klein und hauptsächlich männlich dominiert. Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen wurden ausgeschlossen, was die Übertragbarkeit auf die Gesamtbevölkerung einschränkt. Ebenso weist die relativ kurze Beobachtungsdauer von sechs Monaten darauf hin, dass weitere Langzeituntersuchungen notwendig sind, um nachhaltige Effekte zu validieren. Ein weiteres Problem ist, dass alle Daten selbstberichteter Natur waren.
Die offene Zuweisung, bei der die Teilnehmenden wussten, ob sie legal versorgt waren, könnte die Befragungsergebnisse beeinflusst haben, beispielsweise durch soziale Erwünschtheit. Dennoch bietet diese randomisierte kontrollierte Studie die bislang beste Evidenz, dass eine gesundheitsorientierte Regulierung von Cannabis zumindest bei bestimmten Nutzergruppen einen positiven Einfluss auf den problematischen Konsum haben kann. Für politische Entscheidungsträger bedeutet dies, dass Legalisierungsmodelle mit begleitenden Maßnahmen – wie Qualitätskontrolle, Preissignalen und Beratung – einen Beitrag zur Schadensminderung leisten können. Der Verzicht auf reine Beobachtungsdaten zugunsten experimenteller Designs markiert einen Fortschritt in der Cannabisforschung und legt eine belastbare Grundlage für zukünftige gesundheitspolitische Strategien. Noch im Gange sind weitere Follow-up-Untersuchungen, um die Langlebigkeit der Effekte zu ergründen und zusätzliche gesundheitliche Aspekte wie Atemwegsbeschwerden, Schlafqualität und körperliche Aktivität zu berücksichtigen.
Auch wird geprüft, wie unterschiedliche Zugangsmodelle, beispielsweise soziale Cannabisclubs oder spezialisierte Verkaufsstellen, sich auf Konsummuster und Gesundheit auswirken. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Legalisierung von Cannabis unter strengen staatlichen Auflagen und mit Unterstützungsangeboten den problematischen Gebrauch insbesondere bei Personen mit komplexeren Substanzgebrauchsmustern vermindern kann. Damit trägt reguliertes und legal verfügbares Cannabis nicht nur zur Risiko- und Gesundheitseinschätzung bei, sondern eröffnet auch neue Perspektiven für die Prävention und den Umgang mit Suchtverhalten in modernen Gesellschaften. Die Studie ist ein Meilenstein, der Politik, Gesundheitswesen und Forschung gleichzeitig die Chance bietet, evidenzbasiert und verantwortungsbewusst mit der Legalisierungsdebatte umzugehen.