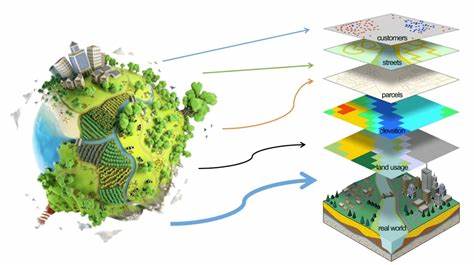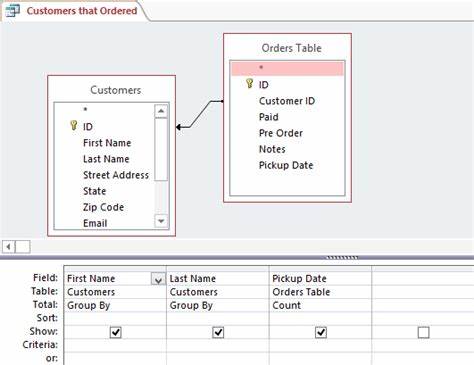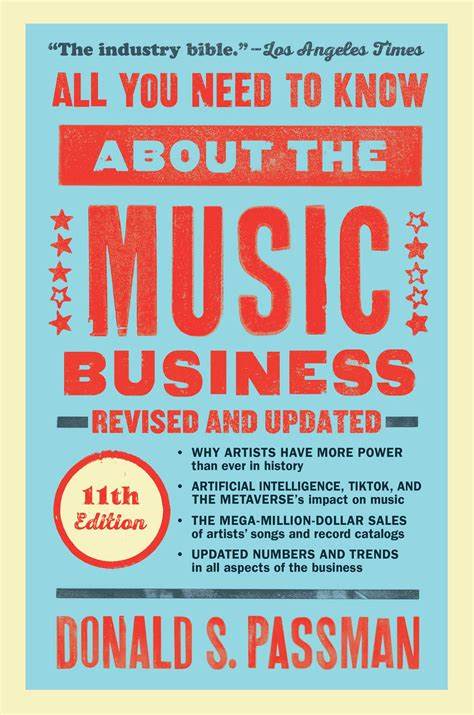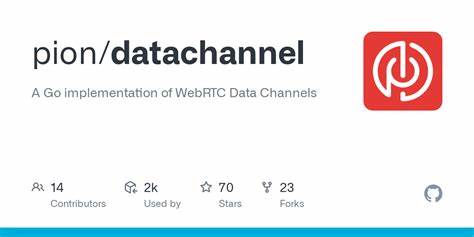In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Haltung der Jugendkultur gegenüber Kommerz grundlegend gewandelt. Wo einst das Mantra „Nicht verkaufen!“ als ethisches Fundament galt, erleben wir heute eine Generation von Kreativen, die den kommerziellen Markt nicht nur akzeptieren, sondern aktiv nutzen, um noch mehr Geschäfte zu machen. Dieses Phänomen wird oft als das Zeitalter des „doppelten Verkaufs“ bezeichnet und stellt einen signifikanten Bruch mit den Werten früherer Jugendkulturen dar. In den 1990er Jahren war die Devise klar und streng: Künstler sollten nicht „verkaufen“. Der Ausdruck „sell-out“ war ein Schimpfwort, das jene traf, die ihre künstlerische Integrität für kommerzielle Vorteile aufgaben.
Alternativkulturen galten als Räume für authentischen Ausdruck und Gemeinschaft, fernab von massenkompatiblen Erwartungen und dem Einfluss der Konzernwelt. Als alternative Musik langsam im Mainstream ankam, führte dies zu erbitterten Debatten unter Jugendlichen – Gespräche darüber, ob bestimmte Bands oder Songs zu kommerziell seien und damit an Authentizität eingebüßt hätten. Die Angst, zum „Poser“ zu werden, war real. Doch im Laufe der späten 1990er Jahre begann sich das Bild zu verändern. Die Grenzen zwischen Mainstream und Alternative wurden unschärfer, und spätestens mit der Rückkehr der fabrikmäßig hergestellten Popstars wie Britney Spears und den Boybands wurde deutlich, dass die Debatte um das „Verkaufen“ zunehmend an Bedeutung verlor.
Kritiker und Fans gleichermaßen akzeptierten, dass Popularität und Kommerz Teil der kulturellen Landschaft geworden waren – und dies durchaus berechtigte Gründe hatte. Die Krise der Musikindustrie durch Napster und den Einbruch der Plattenverkäufe machte klar, dass Musiker neue Wege finden mussten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die sogenannte „Poptimism“ genannte Bewegung formte sich aus diesem neuen Verständnis heraus. Sie setzte sich dafür ein, kommerzielle Popmusik nicht mehr von vornherein als minderwertig oder „uncool“ abzustempeln. Poptimismus zeigte überzeugend auf, dass finanzieller Erfolg keine künstlerischen Ambitionen ausschließen müsse.
Künstler aus marginalisierten Gemeinschaften, etwa im Bereich R&B oder Disco, sollten nicht aufgrund ihrer kommerziellen Ausrichtung diskriminiert werden. Ebenso erlaubte der kommerzielle Erfolg Künstlern, tatsächlich kulturellen Einfluss zu nehmen und ästhetische Grenzen zu verändern. Dieser Wertewandel wirkt bis heute nach. Künstler wie Beyoncé, die nach dem Erreichen von Ruhm und kommerziellem Erfolg mutige kreative Schritte wagten, gelten als Beispiele für ein idealtypisches Verhältnis von Kunst und Kommerz. Ebenso konnten Produzenten wie The Neptunes gefeierte Pop-Hits vorweisen und dennoch künstlerisch anspruchsvolle und experimentelle Musik realisieren.
Der Kompromiss schien zu sein: Einmal „verkaufen“, um die Bühne zu erobern – dann die Freiheit, wirklich bahnbrechende Kunst zu schaffen. Allerdings hat sich in den letzten zwanzig Jahren die Realität wieder verschoben. Die sogenannten Doppel-Verkaufs-Künstler sind heute zu einer dominierenden Kraft geworden. Sie produzieren in erster Linie marktfähige Inhalte, um Ruhm zu erlangen, um dann ihren Bekanntheitsgrad für noch mehr kommerzielle Unternehmungen zu nutzen – oft ohne nennenswerten kreativen Mehrwert. Ein prominentes Beispiel hierfür ist YouTuber MrBeast, der mit aufwendig inszenierten Videos zum größten Kanal auf der Plattform wurde und im Anschluss eine Fast-Food-Kette gründete.
Dieses Vorgehen steht symptomatisch für die heutige Kultur, in der das Streben nach Aufmerksamkeit häufig direkt mit kommerziellen Interessen verknüpft ist. Auch etablierte Stars wie George Clooney, der lange als ernsthafter Schauspieler galt, treten zunehmend als Werbefiguren für globale Marken wie Nespresso auf. Solche Verbindungen sind inzwischen ein fester Bestandteil des Berufslebens vieler Künstler. Im digitalen Bereich zeigt sich das Prinzip besonders deutlich: Influencer wie Emma Chamberlain, die mit persönlichen, nahbaren Videos berühmt geworden sind, nutzen ihre Reichweite, um Coffeeshops und Merchandising-Marken zu etablieren. Die Produkte, die dabei entstehen, sind oft standardisiert, in ihren Differenzierungsmerkmalen flach und zielen vor allem darauf ab, bestehende Fangemeinden zu Kapital zu machen.
Der Prozess, wie diese Produkte entstehen, verdeutlicht die Zynik hinter dem Trend: Hersteller wie Masteroast, die viele der Promi-Kaffeebohnen produzieren, operieren nach einem „Code“-Modell, bei dem lediglich Herstellungsparameter von den Prominenten vorgegeben werden. Das Ergebnis ist eine Massenware, die eher als Markenbotschaft denn als handwerkliches Produkt dient. Es handelt sich nicht mehr um individuelle Kunstwerke, sondern um kalkulierte Verkaufsware. Der kulturbedingte Widerstand gegen das „Verkaufen“ war ursprünglich ein sozialer Konsens, um junge Künstler zu schützen und Kreativität vor reiner Profitgier zu bewahren. Diese spezifische Norm ist heute weitgehend in Auflösung begriffen.
Die ultra-poptimistische Haltung gibt Künstlern das Recht, ungebremst den Profit zu maximieren, ohne dass moralische oder ästhetische Einwände noch durchdringen. Doch diese Entwicklung gefährdet die Qualität und Vielfalt der Kultur, da sie den Markt mit austauschbaren und oft seelenlosen Produkten überschwemmt. Ob wir diesen Wandel gutheißen oder nicht, kulturelle Normen haben reale Auswirkungen. Die Verschiebung von „Nicht verkaufen!“ zu „Verkaufen ist erlaubt“ und sogar „Nicht verurteilen!“ führt zu einer Verflachung des kulturellen Angebots. Produkte wie Chamberlain Coffee symbolisieren die Folgen dieser tiefgreifenden Transformation.
Wenn wir Kultur wieder als eigenständiges Phänomen begreifen wollen und nicht als eine endlose Reihenwerbung für kommerzielle Produkte, müssen wir zumindest eine neue Grenze ziehen: Gegen den doppelten Verkauf, also gegen die Praxis, Ruhm zu erkennen, nur um ihn für noch mehr reine Kommerzialisierung zu nutzen. Dabei wäre diese Normierung ein Kompromiss, der den Künstlern zugesteht, sich erst im kommerziellen Mainstream zu etablieren, um dann ihr Standing für kreative Innovationen oder gesellschaftlichen Nutzen zu verwenden. Künstler, die sich ausschließlich dem doppelten Verkauf verschreiben, verdienen weder kreativen Respekt noch gesellschaftliche Anerkennung. Sie haben sich für die Profitmaximierung entschieden und dafür die Achtung derjenigen eingebüßt, die Kultur als etwas Wertvolles und Weiterentwickelndes begreifen. Die Herausforderung unserer Zeit besteht darin, jene Künstler und Kreativen sichtbarer zu machen, die ihre Plattformen wirklich für Kunst und gesellschaftliche Güter einsetzen – und nicht nur für persönliche Bereicherung.
Jeder Verzicht darauf, den doppelten Verkauf zu kritisieren, ist zugleich eine Beleidigung an die ambitionierten Kreativen, die sich noch an das ursprüngliche Ziel erinnern: Kultur soll uns voranbringen und nicht nur als Marketingvehikel dienen. Im Rückblick auf drei Jahrzehnte scheint klar: Die Beziehung zwischen Jugendkultur, Kunst und Kommerz wird weiterhin dynamisch sein. Die Normen wandeln sich, und mit ihnen die Erwartungen und Werte. Das Zeitalter des doppelten Verkaufs fordert uns heraus, Kultur neu zu definieren und bewusster mit unseren Wertvorstellungen umzugehen – für eine kreative Zukunft, die mehr als bloß Verkaufszahlen umfasst.