Die Entscheidung, eine Datenbankplattform zu wechseln, ist für jedes Unternehmen eine bedeutende Herausforderung. Besonders wenn es um die Migration von verteilten Systemen wie CockroachDB zu einem traditionellen, aber leistungsfähigen relationalen Datenbanksystem wie PostgreSQL geht, steht neben technischen Fragen vor allem die Frage der Skalierbarkeit, Performance und langfristigen Kosteneffizienz im Vordergrund. Das Beispiel eines schnell wachsenden Unternehmens aus dem Bereich KI-Workflow-Software zeigt eindrucksvoll, wie eine gut durchdachte Migration nicht nur bestehende Probleme löst, sondern auch Raum für zukünftiges Wachstum schafft. Zu Beginn war CockroachDB die Datenbank der Wahl, vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit zur mühelosen horizontalen Skalierung und der hohen Verfügbarkeit, die gerade für Multi-Region-Setups relevant ist. Besonders Anforderungen wie die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) verdeutlichen, wie wichtig geografisch verteilte Datenhaltung sein kann.
Mit einer SQL-kompatiblen Schnittstelle bot CockroachDB gute Ansätze für den Einsatz. Doch mit zunehmendem Datenvolumen und wachsender Nutzung zeigte sich, dass die Verteilung der Daten nicht immer ein Vorteil ist – insbesondere wenn die meisten Nutzerdaten in einer einzigen Region verbleiben und aufwändige Multi-Region-Synchronisationen keine unmittelbare Notwendigkeit sind. Im Verlauf der Nutzung stiegen die Betriebskosten bei CockroachDB rapide an und erreichten bis Ende 2024 ein Mehrfaches der ursprünglichen Summen. Die Gebühren für eine verteilte Datenbank mit hoher Verfügbarkeit und weltweiter Infrastruktur sind zwar gerechtfertigt, jedoch stellt sich für viele Unternehmen die Frage, ob diese Kosten durch Effizienzgewinne gerechtfertigt werden – vor allem wenn die Anforderungen an eine globale Verteilung nicht voll ausgeschöpft werden. Ein weiterer Problempunkt zeigte sich bei der Durchführung von Migrationen.
Das vorliegende Beispiel illustriert, wie das auf ORM (Object-Relational Mapping) basierende Prisma-Tool häufig aufgrund von Timeouts blockierte. CockroachDB konnte einfache Schemaänderungen in bei weitem nicht der zu erwartenden Zeit umsetzen. Eine einfache Modifikation, etwa das Hinzufügen einer neuen Spalte, dauerte teilweise mehrere Minuten oder konnte sogar zu Systemblockaden führen. Die Folge waren manuelle Eingriffe in die Datenbank sowie verzögerte Deployments, was die Produktivität und Stabilität des Systems erheblich beeinträchtigte. Im Gegensatz dazu zeigte sich PostgreSQL unter gleichen Bedingungen deutlich stabiler und schneller.
Die Migrationen wurden in Sekunden abgeschossen, was mit Blick auf den Entwicklungszyklus und die Betriebssicherheit einen entscheidenden Vorteil darstellt. Auch wenn CockroachDB den Vorteil hat, komplexe Join- und Aggregationsabfragen in bestimmten Szenarien schneller auszuführen, leidet es unter der Komplexität der von ORM generierten SQL-Abfragen, die oft ineffizient sind und zu unerwarteten hohen Latenzen führen. PostgreSQL hingegen bewältigte die gleichen Abfragen wesentlich effizienter und reduzierte die Latenzen häufig um ein Vielfaches. Ein großes Problem betraf auch externe Prozesse wie ETL-Jobs (Extract, Transform, Load), die für die Datenintegration und -verarbeitung notwendig sind. CockroachDB verfügte nur über eine begrenzte Auswahl an Integrationswerkzeugen, die zudem nicht stabil liefen oder gar mit einem Speicherleck belastet waren.
Die Folge waren häufige Zeitüberschreitungen und unterbrochene Datenflüsse, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Datenkonsistenz und den gesamten Betrieb hatten. PostgreSQL bot dagegen durch sein langjährig etabliertes Ökosystem und die große Anzahl an unterstützten Tools einen erheblichen Mehrwert, der sich in besserer Stabilität und einfacherer Integration manifestiert. Technisch stand die Migration vor einer weiteren Hürde: Unterschiede in der Datenkodierung zwischen CockroachDB und PostgreSQL, insbesondere bei JSON- und Array-Daten. Ein direktes 1:1-Dumping war nicht möglich, weshalb ein eigens entwickeltes Migrationstool notwendig wurde. Dieses basierte auf dem damals aufstrebenden Bun-Framework, das parallele Datenströme aus CSV-Dateien erzeugte, um die Daten effizient in PostgreSQL einzulesen.
Die präzise Aufbereitung, die Datenkompatibilität sicherstellte und gleichzeitig identische Datenstrukturen gewährleistete, erforderte intensive Tests und Anpassungen. Die erfolgreiche Migration verlief dennoch beeindruckend schnell. Trotz einer enormen Datenmenge mit etwa 100 Millionen Einträgen dauerte der eigentliche Umzug nur etwa 15 Minuten auf einer leistungsstarken Cloud-VM mit 128 CPU-Kernen. Um Ausfallzeiten möglichst gering zu halten, wurde eine Wartungsphase angesetzt und der Datenverkehr schrittweise wieder hochgefahren, was das Risiko minimierte und gleichzeitig den reibungslosen Betrieb nach der Migration sicherstellte. Die unmittelbaren Vorteile schälten sich schnell heraus: Ein spürbarer Rückgang der Latenzen bei API-Anfragen um etwa ein Drittel wirkte sich positiv auf die Nutzerzufriedenheit aus.
Zudem enthüllten Monitoring-Tools wie PGAnalyze eine Reihe ineffizienter Abfragen, die post-migration rasch optimiert werden konnten. Die Performance-Steigerung durch eine Kombination aus besserem Query-Planer, fehlender Notwendigkeit für komplexe Verteilungsmechanismen und zusätzlichen Optimierungen spiegelt sich auch in signifikanten Kosteneinsparungen wider – das Unternehmen reduzierte seine jährlichen Ausgaben um mehr als 110.000 US-Dollar, eine Summe, die mit wachsendem Datenaufkommen noch weiter steigen dürfte. Neben den technischen Vorteilen spielten auch operative Punkte eine Rolle. CockroachDB brachte Herausforderungen im Bereich der Benutzeroberfläche mit sich: So sorgten unklare Indizierungswarnungen für Verwirrung bei Entwicklerteams.
Das Abbrechen lang laufender Abfragen war aufgrund der verteilten Clusterarchitektur mühsam und fehleranfällig, da mitunter einzelne Knoten nicht ordnungsgemäß reagierten. Die benötigten Supportprozesse gestalteten sich aufgrund ausgelagerter Portale und langsamer Antwortzeiten als frustrierend. Ähnlich problematisch waren permanente Verbindungsprobleme, etwa beim Einsatz von VPN-Lösungen wie Tailscale, die plötzlich auftauchten und ohne erkennbare Ursache wieder verschwanden. Zum Vergleich blieb PostgreSQL trotz eines hochgradig verteilten Betriebsmodells in diesen Umgebungen ohne derartige Instabilitäten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Migration von CockroachDB zu PostgreSQL für Projekte mit zentralem Anwendungsfall in einer Region und klassischen relationalen Datenstrukturen eine sehr sinnvolle Option darstellt.
Sie bietet nicht nur Kostenvorteile, sondern auch eine bessere Performance, stabilere Betriebsmethoden und eine größere Auswahl an unterstützenden Tools und Monitoring-Lösungen. Für Unternehmen, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, ist eine umfassende Analyse der eigenen Datenbanknutzung, der Anforderungen an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sowie der Kostenstruktur essentiell. Gerade die Erfahrung zeigt, dass moderne relationale Datenbanken wie PostgreSQL mit ihrem stetig wachsenden Ökosystem und Leistungsfähigkeit oft mehr Vorteile bringen als ursprünglich angenommen – insbesondere wenn keine zwingenden Gründe für komplexe verteilte Systeme vorliegen. Nicht zuletzt unterstreicht das Beispiel eines einzelnen Entwicklers, der die gesamte Migration über mehrere Wochen selbst umgesetzt hat, wie wichtig Innovationsfreude und Pragmatismus sind. Eine wohlüberlegte Migration ermöglicht es, technische Schulden abzubauen, die Infrastruktur zu vereinfachen und die Leistung für das gesamte Unternehmen nachhaltig zu verbessern.
Jetzt liegt der Fokus auf den neuen Möglichkeiten, die der Leistungszuwachs und die niedrigeren Betriebskosten eröffnen. So können Entwicklerteams neue Features einführen, ohne von Datenbankproblemen ausgebremst zu werden, und das Unternehmen profitiert von einer stabileren und skalierbaren Basis für zukünftige Anforderungen. Das zeigt eindrucksvoll, dass der Wechsel zu PostgreSQL nicht nur eine technische Entscheidung war, sondern ein strategischer Schritt in Richtung nachhaltigen Wachstums und verbesserter Wettbewerbsfähigkeit.
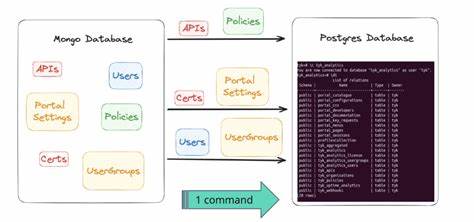








![Hyatt Regency walkway collapse – A Case Study [pdf]](/images/2226BB88-6DA8-4BE4-8BF9-487538EB60A4)