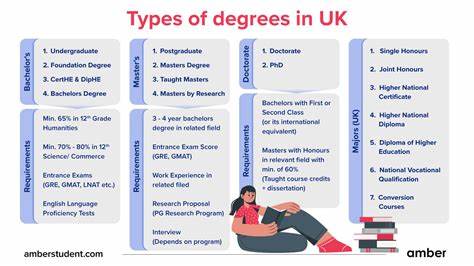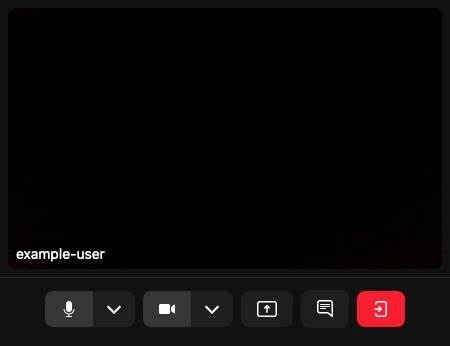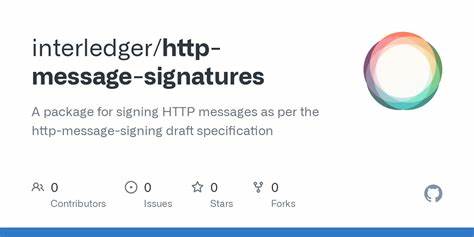In der heutigen akademischen Landschaft der Vereinigten Staaten entsteht gerade ein zunehmend besorgniserregendes Bild bezüglich der Lese- und Verständnisfähigkeiten von College-Studierenden, insbesondere jener, die Englisch als Hauptfach studieren. Obwohl man davon ausgeht, dass diese Studierenden über ausgeprägte Lesekompetenzen verfügen sollten, offenbart eine aktuelle Studie tiefgreifende Schwächen, die nicht nur überraschen, sondern auch weitreichende Fragen über die Qualität der Hochschulbildung aufwerfen. Die Kernfrage lautet: Können Englisch-Majors in den USA wirklich komplexe literarische Texte lesen und verstehen – jene Fähigkeit, die eigentlich das Fundament ihres Studiums bilden sollte? Die Antwort scheint ernüchternd auszufallen. Begriffe wie „funktionale Literalität“ gewinnen in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung. Funktionale Literalität beschreibt die Fähigkeit, nicht nur einfache Texte verstehen zu können, sondern auch anspruchsvolle, dichte und teils abstrakte Texte zu erfassen, welche mehrere Seiten umfassen, verschiedene Informationsquellen bündeln und komplexe Schlussfolgerungen erfordern.
Nach Maßgaben der PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) erreichen nur rund 12 Prozent der US-Erwachsenen das Niveau 4 oder höher auf einer Literaturskala von 1 bis 5. Eine solche Klassifikation beinhaltet die Kompetenz, abstrakte und mitunter ungewohnte Inhalte in längeren Texten zu reflektieren und sinnvoll zu verarbeiten. Wenn man berücksichtigt, dass über 60 Prozent der amerikanischen Highschool-Absolventen ein Studium aufnehmen, führt dies zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, dass die überwiegende Mehrheit der College-Studierenden die für ihre akademischen Aufgaben nötigen Lesefähigkeiten auf diesem hohen Niveau schlichtweg nicht besitzt. Anders formuliert: Viele junge Erwachsene an Hochschulen zählen im Grunde als funktional analphabetisch, zumindest wenn man die Anforderungen an eine universitäre Textkompetenz zugrunde legt. Eine besonders eindrucksvolle Untersuchung, die in der Fachwelt für Aufsehen sorgt, hat sich diesem Thema gewidmet und die Lesefähigkeiten von College-Englisch-Studierenden an zwei öffentlichen Universitäten in Kansas genauer unter die Lupe genommen.
Die Studierenden wurden gebeten, einen stark herausfordernden historischen Romantext von Charles Dickens, genauer die ersten sieben Absätze seines Klassikers "Bleak House", laut vorzulesen und gleichzeitig ihre Verständnisprozesse in einem Gespräch zu erläutern. Dabei standen ihnen Wörterbücher, Referenzmaterialien und digitale Hilfsmittel zur Verfügung, um unbekannte Begriffe zu recherchieren. Die Auswahl von "Bleak House" als Prüfstein ist kein Zufall. Das Werk zeichnet sich durch eine dichte, komplexe und teilweise archaische Sprache aus, die für heutige Leser, selbst für wellgebildete Hochschulstudierende, durchaus herausfordernd sein kann. Beispielsweise wird das Bild einer mit Schlamm bedeckten Straße durch die metaphorische Beschreibung von Dinosauriern illustriert, die „waddling“ die Straßen hinaufgehen, eine bildliche Übertreibung, die erfasst werden muss, um den Sinn vollständig zu verstehen.
Die Ergebnisse der Untersuchung offenbaren eine alarmierende Realität: Über die Hälfte der Studienteilnehmer (58 Prozent) konnten von den Absätzen so wenig verstehen, dass sie praktisch nicht in der Lage wären, den gesamten Roman eigenständig zu lesen. Das verblüfft umso mehr, wenn man bedenkt, dass diese Probanden im Durchschnitt über ein Leseverständnis auf hohem Highschool-Niveau verfügen – ihr Durchschnittswert auf dem standardisierten Degrees of Reading Power-Test liegt über der 10. Klasse. Dennoch scheiterte die Mehrheit offensichtlich an der Komplexität und der sprachlichen Tiefe der literarischen Vorlage. Etwa 38 Prozent der Studierenden zeigten zwar ein besseres Verständnis, erkannten aber dennoch nur ungefähr die Hälfte der wörtlichen Bedeutung.
Die Fähigkeit, zwischen wörtlichen und bildhaften Bedeutungen zu unterscheiden und abstrakte Sprachbilder zu interpretieren, war insgesamt sehr gering ausgeprägt. Lediglich rund fünf Prozent der getesteten Studenten erreichten eine detaillierte und präzise inhaltliche Erfassung der anspruchsvollen Textpassage. Was bedeuten diese Ergebnisse? Sie werfen ein Schlaglicht auf eine tief verwurzelte Problematik: Selbst Studierende, die sich auf Literatur spezialisieren und in naher Zukunft als Lehrerinnen und Lehrer literarische Klassiker weitergeben sollen, verstehen nicht zwangsläufig die sprachlichen und inhaltlichen Grundlagen ihrer Fachtexte. Dies unterminiert nicht nur die Qualität der Hochschulausbildung, sondern stellt auch die spätere Vermittlungskompetenz dieser zukünftigen Pädagogen infrage. Eine Englischlehrerin oder ein Englischlehrer, die oder der selbst Schwierigkeiten hat, zentrale Figuren, sprachliche Bilder oder historische Bezüge zu erfassen, kann kaum adäquat Unterricht gestalten.
Ein exemplarisches Problem ist die Unfähigkeit, metaphorische und figurative Sprache angemessen zu interpretieren. So missverstehen viele Studierende Figuren wie den Lord Chancellor oder Begriffe wie „Michaelmas Term“, die historische Kontexte voraussetzen und in der heutigen Alltagssprache selten vorkommen. Selbst bei verfügbarer Recherchehilfe beispielsweise per Smartphone bleibt die kognitive Belastung meist so hoch, dass kein kohärentes Verständnis möglich wird. Das Hinzuziehen von Wörterbüchern verhindert eine Überforderung demnach nicht. Diese Entwicklung ist alarmierend, weil sie zutage fördert, wie sehr die Annahme, Studierende erarbeiten sich mit fortschreitendem Studium automatisch die erforderlichen Lese- und Denkkompetenzen, fehlgeht.
Die Studie offenbart vielmehr, wie ein gravierendes Missverhältnis zwischen den akademischen Erwartungen und den tatsächlichen Fähigkeiten der Studierenden besteht. Zudem steht fest, dass viele von ihnen mit relativ niedrigen ACT-Leseergebnissen ins College starten, deren Leistungsniveau laut Bildungsexperten nicht ansatzweise mit der für Literaturstudien erforderlichen Leseprofi-Level vergleichbar ist. Eine solche Dysbalance hat Folgen, die weit über akademische Misserfolge hinausgehen. Das Verpassen grundlegender Lese- und Textkompetenzen wirkt sich auch auf den weiteren Berufsweg und das Privatleben aus, denn literarische und komplexe Sachtexte sind mehr als akademische Übungen. Sie fördern kritisches Denken, kontextuelles Verstehen und die Fähigkeit, Vielschichtiges zu durchdringen – Kompetenzen, die im 21.
Jahrhundert hohe Relevanz besitzen. Auch wenn es naheliegt, diese Misere auf gesellschaftliche, kulturelle oder demografische Veränderungen zurückzuführen, zeigt die Untersuchung exemplarisch, dass selbst an öffentlichen Universitäten mit vorwiegend weißen Studierenden der Rückstand in den Lesefähigkeiten eklatant ist. Das Problem scheint also grundsätzlicher und systemischer Natur zu sein und nicht nur bestimmte Gruppen oder Regionen zu betreffen. Die Autoren der Studie appellieren folglich eindringlich an die akademische Gemeinschaft, nicht länger blind gegenüber den realen Lesekompetenzen ihrer Studierenden zu sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Abschlüsse vergeben werden, deren Inhaber essenzielle Fähigkeiten zum Umgang mit komplexem Textmaterial nicht besitzen.
Eine solche Entwicklung beschädigt nicht nur den Wert der Abschlüsse selbst, sondern auch das Vertrauen in die Hochschulbildung generell. Für Institutionen und Lehrende mag dies zunächst wie eine erdrückende Herausforderung erscheinen, denn remediale Maßnahmen beziehungsweise ein verpflichtender Förderungscurriculum zum Aufbau von Lesekompetenzen sind in vielen Fällen nicht etabliert. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob traditionelle Unterrichtsformen und die Erwartung, dass Studierende sich diese Fähigkeiten selbst aneignen, noch zeitgemäß oder realistisch sind. Zusammenfassend spiegelt die Analyse der Lesekompetenz von Englisch-Majors in US-Colleges ein alarmierendes Bild wider, das dringenden Handlungsbedarf signalisiert. Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Wirklichkeit offenbart eine Schwäche im Bildungssystem, die sich nicht länger ignorieren lässt.
Soll Hochschulausbildung ihrem Anspruch gerecht werden, komplexes Denken und Problemlösungsfähigkeiten zu fördern, müssen Strukturen geschaffen werden, die effektiver und frühzeitiger die notwendigen Lesequalifikationen vermitteln. Andernfalls droht nicht nur ein Qualitätsschwund in der akademischen Ausbildung, sondern auch eine Generation, der wichtige Kompetenzen fehlen, um sich gesellschaftlich und beruflich erfolgreich zu behaupten.