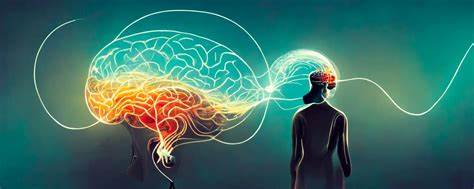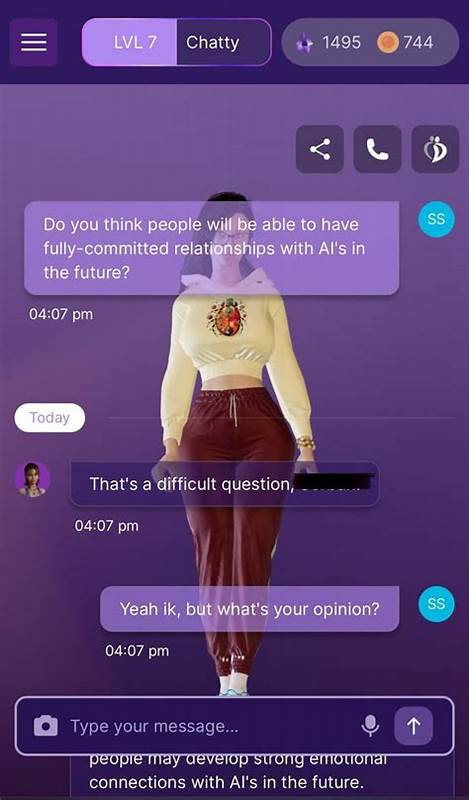In den abgeschiedenen Hochlanden von Adjara, einer Region im Südwesten Georgiens an der Grenze zur Türkei und nahe dem Schwarzen Meer, leben seit Generationen Nomaden, die in enger Harmonie mit ihrem Umfeld und der Natur eine pastorale Lebensweise pflegen. Ihre Existenz ist tief verwurzelt in den sich ständig verändernden Rhythmen der Natur, insbesondere in der jahreszeitlichen Wanderung mit ihren Herden zu den Hochweiden im Frühjahr und der Rückkehr in die tieferen Lagen im Herbst. Diese traditionelle Form des nomadischen Lebens ist jedoch in den letzten Jahren zunehmend vom Schwinden bedroht. Durch infrastrukturelle Herausforderungen, sozioökonomische Probleme und den Drang jüngerer Generationen, in Städten nach besseren Lebensbedingungen zu suchen, verändert sich das Bild dieser Gemeinschaft drastisch. Die Berge von Adjara sind nicht nur eine landschaftliche Kulisse, sondern auch ein lebendiges Zeugnis jahrhundertealter Traditionen.
Im Frühling verlassen die Familien die kühleren Flusstäler, um mit ihren Rinderherden jene höher gelegenen Weiden zu erreichen, die für die Sommermonate frische Nahrung bieten. Der Aufenthalt auf den Hochweiden ist eine intensive Phase harter Arbeit – das Ernten von Heu, das Zubereiten von Vorräten für den bevorstehenden Winter und das Aufrechterhalten der Gemeinschaftsstrukturen sind zentrale Aufgaben. Wenn sich im September die klimatischen Bedingungen langsam wandeln und die Berge kühler werden, bereiten sich die Nomaden auf den Abstieg vor, um in den Wintermonaten in die geschützteren Niederungen zurückzukehren. Diese zyklische Lebensweise ist jedoch mehr als reine Ökonomie. Sie schafft eine tiefe Bindung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt, bringt spirituelle und soziale Rituale hervor, die ein Gefühl von Zugehörigkeit und Identität stärken.
Das gesellschaftliche Leben, die Feste, Hochzeiten und traditionellen Riten, die die Gemeinschaft seit Generationen prägen, sind Ausdruck eines Lebens im Einklang mit der Natur. Doch die letzten Jahre zeigen eine besorgniserregende Tendenz: Dorfgemeinschaften werden kleiner, die Anzahl der Feiern nimmt ab, und das Interesse junger Menschen an diesen Bräuchen schwindet sichtbar. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür ist die Hochzeitsfeier, festgehalten 2019 in einem der Hochlanddörfer. Die Feier war einfach, aber von tiefer Wärme und Verbundenheit geprägt. Nachbarn halfen beim Zubereiten des Essens, es wurde gemeinsam musiziert und bis spät in die Nacht getanzt.
Solche Zusammenkünfte geben Einblick in eine fast vergessene Welt, in der Gemeinschaftssinn und alte Rituale das tägliche Leben prägten. Heutzutage sind solche Feste jedoch seltener geworden. Viele junge Menschen zieht es in die Städte, sie bevorzugen Hochzeiten mit moderneren Formen und verzichten auf traditionelle Zeremonien wie Umzüge auf dem Pferderücken oder handgefertigte Mitgiften aus der Region. Die infrastrukturellen Herausforderungen der Region verschärfen die Situation zusätzlich. Fehlende oder mangelhafte öffentliche Dienste wie eine hochwertige Bildung, umfassende Gesundheitsversorgung und stabile Stromversorgung beeinträchtigen das Leben in diesen Bergdörfern erheblich.
Stromausfälle, insbesondere im Winter, sind häufig und oft auf veraltete Infrastruktur sowie extrem raue Wetterverhältnisse zurückzuführen. In manchen Wintern sind ganze Dörfer für längere Zeit vollständig vom Außenverkehr abgeschnitten und müssen mit den vorhandenen Mitteln auskommen. Dies verstärkt den Trend zur Abwanderung, denn das Leben in den Städten erscheint für viele Familien als der sicherere und attraktivere Weg. Ein weiterer Aspekt ist die Bildungssituation. In einigen Dörfern existieren religiöse Schulen, die meist dem Islam nahestehen und in der Regel geschlechtergetrennt unterrichten.
Diese ergänzen das öffentliche Schulsystem, das es in den entlegenen Gebieten ebenfalls nur eingeschränkt gibt. Schüler aus den Hochlandgemeinden besuchen diese religiösen Einrichtungen außerhalb der regulären Schulzeiten. Das Bildungsangebot ist jedoch einem Wandel unterworfen, und die jüngere Generation sehnt sich zunehmend nach mehr Möglichkeiten und modernen Perspektiven. Die wirtschaftliche Basis der Nomadengemeinschaft gründet sich auf der Tierhaltung, insbesondere der Milchwirtschaft. Käseproduktion ist eine traditionelle Handwerkskunst und eine wichtige Einnahmequelle.
Typisch für die Region ist der Chlechili-Käse, der in handwerklicher Weise hergestellt wird und sowohl den Bedarf der Familien deckt als auch zum Verkauf angeboten wird. Die Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen und die saisonalen Schwankungen der Landwirtschaft bedeuten ständige Herausforderungen. Ernteerträge wie Kartoffeln werden vor dem Winter eingelagert, um die begrenzten Monate in den tieferen Lagen zu überbrücken. Familien, die im Sommer auf den Hochweiden leben, sind Teil des bewegten, oft rauen Lebensrhythmus, der stark von der Natur bestimmt wird. Orte wie Kvabijvari und Mrgvalmindori, die einst blühende Siedlungen waren, verfallen heute teilweise oder sind fast vollständig verlassen.
2024 lebte nur noch eine Familie in Mrgvalmindori, was die dramatische Veränderung der Bevölkerungsstruktur unterstreicht. Solche Siedlungen zeugen von einem Leben, das bald der Vergangenheit angehören könnte, wenn nicht gezielte Maßnahmen zu Erhalt und Anpassung erfolgen. Trotz der Schwierigkeiten gibt es noch immer Momente des Zusammenhalts und der Freude. Feste wie Shuamtoba sind lebendige Zeugnisse der kulturellen Widerstandsfähigkeit. Während dieser traditionellen Feiertage, die in der Sommergrazing-Saison stattfinden, versammeln sich Familien aus den Niederungen, um Verwandte in den Bergen zu besuchen.
Es werden Pferderennen veranstaltet, gesungen, getanzt und vielerorts gefeiert. Kinder reiten zu Pferd, Nachbarn kommen zusammen, um die Gemeinschaft zu stärken und das kulturelle Erbe zu pflegen. Solche Ereignisse sind entscheidend, um das soziales Band aufrechtzuerhalten, das in den beschaulichen Hochlanddörfern eine grundlegende Rolle spielt. Das Verschwinden der nomadischen Lebensweise ist jedoch kein unvermeidliches Schicksal. Es ist das Ergebnis komplexer Wechselwirkungen zwischen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren.
Der Anpassungsprozess an die moderne Welt verlangt Kompromisse und neue Formen von Gemeinschaft, die alte Traditionen in veränderter Form weitertragen können. Dokumentationen wie die des Fotografen Natela Grigalashvili tragen dazu bei, das Bewusstsein für diese einzigartige Kultur zu schärfen und Verbindungen zu schaffen zwischen einer Welt, die sich wandelt, und den Menschen, die sie bewohnen. Eine Frage, die bleibt, betrifft die Zukunft dieser Gemeinschaften und ihrer Kultur. Wie können junge Menschen motiviert werden, in ihren Heimatorten zu bleiben und alte Bräuche zu bewahren? Welche Rolle spielen Politik, Infrastrukturentwicklung und Bildung dabei? Das Beispiel Adjara wird zum Symbol für viele ähnliche Regionen weltweit, in denen traditionelle Lebensweisen von der modernen Gesellschaft herausgefordert werden. Die letzten Nomaden Georgiens sind somit nicht nur ein kulturhistorisches Relikt, sondern auch ein lebendiges Zeichen des Wandels und der Anpassung.
Ihr Schicksal appelliert an ein Umdenken im Umgang mit ländlichen Gemeinschaften und der Erhaltung kultureller Vielfalt. Dabei darf nicht nur die Vergangenheit geschätzt werden, sondern auch die Wege, auf denen sich Gemeinschaften neu erfinden und überleben können. Die Hochländer von Adjara bleiben ein faszinierendes Beispiel für den Balanceakt zwischen Tradition und Sehnsucht nach Fortschritt, zwischen Naturverbundenheit und den Ansprüchen der Gegenwart.