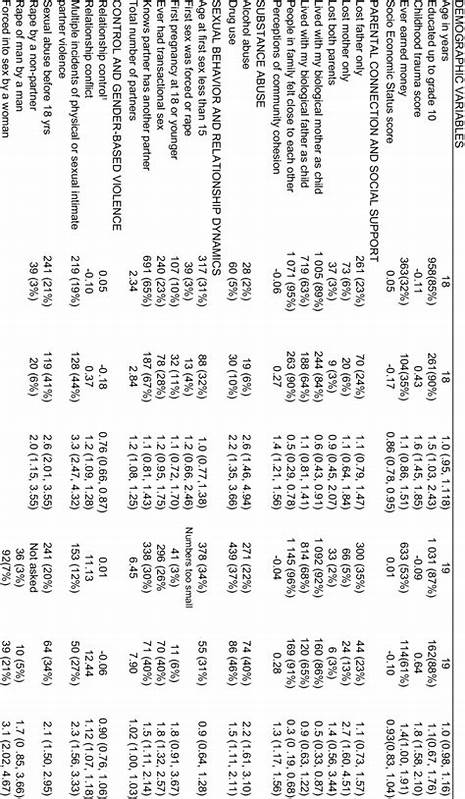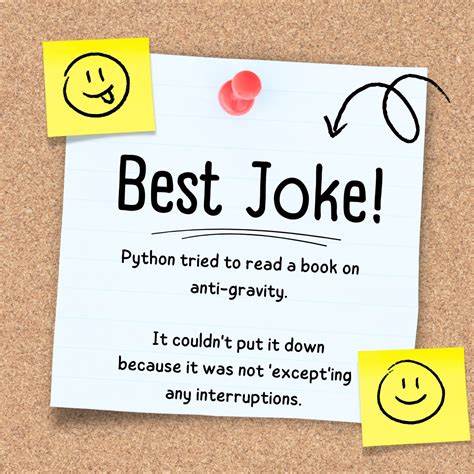Python gilt seit Jahren als eine der beliebtesten und einsteigerfreundlichsten Programmiersprachen weltweit. Mit ihrer klaren Syntax und den einfachen Konzepten ermöglicht sie es Anfängern und Profis gleichermaßen, schnell funktionalen Code zu schreiben. Doch wie sieht das genaue Gegenteil aus? Wie schafft man es, Python-Code so schlecht wie möglich zu machen – und warum sollten wir eigentlich darüber sprechen? Obwohl auf den ersten Blick absurd, bietet das humorvolle Studium schlechter Programmierpraktiken eine hervorragende Möglichkeit, wertvolle Lektionen und Best Practices besser zu verstehen. Der erste Schritt zum absichtlich schlechten Python-Code beginnt mit der Benennung von Variablen und Funktionen. Anstatt sprechende, verständliche Namen zu verwenden, sollte man diese möglichst kryptisch und unverständlich gestalten.
Beispielsweise Funktionen mit Namen wie „f“ oder „do“ wirken nicht nur verwirrend, sondern bringen auch jedem, der den Code später lesen muss, das pure Kopfzerbrechen. Variablen mit Bezeichnungen wie „a“, „b“ oder noch besser „data1“, „temp“ und „result“ mehrfach zu verwenden verstärkt diese Wirkung. Damit wird die eigentliche Logik hinter dem Code zum Rätsel, was besonders in Krisensituationen, etwa einer Produktivumgebung im Fehlerfall, zu enormen Verzögerungen führen kann. Ein weiterer Klassiker schlechter Programmierung ist der Verzicht auf Kommentare oder das Hinterlassen von irreführenden Kommentaren. Kommentare sollten eigentlich den Code verständlicher machen und anderen Entwickler:innen dabei helfen, Algorithmen, Funktionsweisen oder komplexe logische Zusammenhänge zu erfassen.
Stattdessen kann man attraktive Kommentare schreiben, die das genaue Gegenteil leisten. So sorgen Phrasen wie „Provisorium, wird später besser“ oder unnötige Wiederholungen dafür, dass niemand mehr versteht, was eigentlich passiert ist. Noch besser ist es, Code so zu schreiben, dass er vermeintlich offensichtlich ist, aber in Wirklichkeit zwiespältig interpretiert werden kann. So entsteht maximaler Verwirrung. Die bewusste Missachtung des Prinzips der Modularität trägt ebenfalls zur Verschlechterung bei.
Komplexe Logik in enorm lange Funktionen zu stopfen, ohne sich die Mühe zu machen, wiederverwendbare Komponenten zu schaffen, macht es schwer, Teile des Programms zu testen oder zu pflegen. Warum sollte man eine Funktion auf mehrere kleine, überschaubare Einheiten verteilen, wenn man stattdessen alle Aufgaben in eine einzige „Monsterfunktion“ quetschen kann? Gerade wenn innerhalb dieses Codes auch noch global verwendete Variablen ohne Not deklariert werden, ist Chaos vorprogrammiert. Solche Praktiken erschweren nicht nur das Verständnis, sondern setzen auch die Stabilität der Anwendung massiv aufs Spiel. Auch das Fehlerhandling gehört zu den Feldern, auf denen sich schlechtes Programmieren besonders gut auszeichnet. Wer möchte schon Fehler klug abfangen und sauber verarbeiten? Stattdessen kann man versuchen, jegliche Fehler großzügig zu ignorieren oder sie mit generischen Ausnahmebehandlungen zu verhehlen, die keine wirklichen Hinweise auf die Ursache liefern.
Python bietet hier das try-except-Konstrukt, das man problemlos missbrauchen kann, um sämtliche Ausnahmen zu schlucken und den Code einfach weiterlaufen zu lassen, egal was passiert. Das führt früher oder später zu undurchschaubaren Bugs und macht das Debuggen zu einer Tortur. Darüber hinaus ist die bewusste Vernachlässigung von PEP8 – dem offiziellen Styleguide für Python – ein weiterer Weg, das Übel zu maximieren. Inkonsistente Einrückungen, fehlende Leerzeichen, verirrte Groß- und Kleinschreibung sowie wild zusammengefügte Zeilen zerstören die Lesbarkeit in Windeseile. Dabei fällt schon bei kleinen Programmen auf, wie hilfreich eine saubere Formatierung ist, um schnell den Aufbau und die Struktur zu erfassen.
Wer es anders machen will, sollte rigoros darauf verzichten, Tabulatoren konsistent zu verwenden, oder sie verrücken, sodass Syntaxfehler entstehen. Ein worst-practice-Cocktail, der auf jeder Code-Review mit roter Tinte markiert wird. Nicht zu vergessen ist der Mangel an Tests. Professionelle Entwickler:innen investieren viel Zeit in Unit-Tests, Integrationstests und kontinuierliche Überprüfung, um Qualität sicherzustellen. Wer jedoch schlechten Code schreiben möchte, ignoriert diese Vorgehensweise komplett.
Tests sind überflüssig, beschneiden die Freiheit des Entwicklers oder werden bewusst so unvollständig geschrieben, dass sie keinerlei Aussagekraft haben. Der Code läuft entweder einmal, oder eben nicht, Probleme entdeckt man dann später „im Feld“ – und genau dadurch steigt der Frust in der Wartungsperson. Schlechte Python-Entwickler könnten sich auch darin üben, komplexe, aber unnötige Konstrukte einzubauen. Ein Beispiel dafür sind verschachtelte List Comprehensions ohne klaren Nutzen oder Einsatz von Lambdas an Stellen, wo klare Funktionsdefinitionen viel besser lesbar wären. Solche Manöver tun zwar so, als wären sie clever, sind in Wirklichkeit aber reine Stolpersteine, die die Fehleranfälligkeit erhöhen und den Wartungsaufwand ins Unermessliche steigern.
Entgegen der Philosophie von Python, „Lesbarkeit zählt“, machen schlechte Code-Beispiele das Ganze zur Nebensache. Sie setzen vielmehr auf obskure Sprachfeatures, sinnlose Einzeiler oder Verschleierungstaktiken, die Entwickler:innen zur Verzweiflung bringen. Ganz gleich ob es sich um übermäßigen Gebrauch von globalen Variablen handelt, unverständliche Einrückungen oder das Ignorieren von grundlegenden Konzepten wie klaren Datenstrukturen – der Umgang mit solchem Code ist so frustrierend, dass er zu einem Lehrbeispiel für alles wird, was man nicht tun sollte. Warum also überhaupt darüber sprechen? Abgesehen von dem humoristischen Wert zeigt das bewusste Studium schlechter Programmiervorgänge, wie wichtig saubere und verständliche Kodierung ist. Jeder Entwickler, der schon einmal Stunden oder Tage damit verbracht hat, kryptischen Code zu verstehen, weiß, wie viel produktiver ein gut strukturierter und kommentierter Workflow ist.
Das Reflektieren darüber, was den eigenen Code zerstört, hilft dabei, das eigene Verhalten zu hinterfragen und dauerhaft zu verbessern. Wer also agil, effektiv und professionell Software entwickeln will, sollte sich bewusst gegen die hier beschriebenen Muster entscheiden. Statt kryptischer Namen sollten beschreibende Bezeichnungen zum Einsatz kommen. Statt verschwommener Konstrukte sind einfache, gut wartbare Lösungen gefragt. Statt ignoriertem Fehlerhandling gibt es klare Kontrollen, die für Stabilität sorgen.
Und anstelle einer vernachlässigten Formatierung erfreuen sich Teams an sauberem, lesbarem Code, der kollaboratives Arbeiten fördert und nachhaltig überzeugt. Am Ende bleibt festzuhalten, dass man wirklich schlimmsten Python-Code mit Begeisterung und einer Prise Ironie selbst erschaffen kann. Noch wertvoller ist es aber, die dahinterstehenden Prinzipien zu verstehen und dadurch besseren, wartbaren und für alle nachvollziehbaren Code zu schreiben. Das ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Karriere als Softwareentwickler und das Ziel, das jeder anstreben sollte.
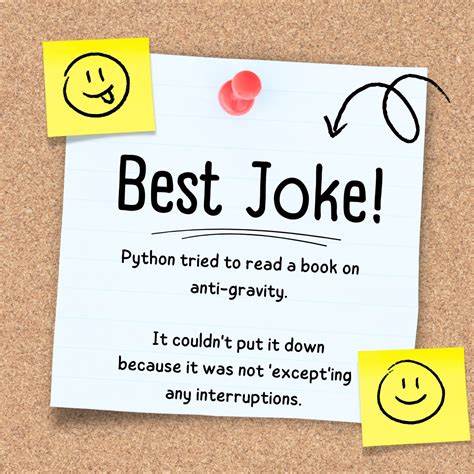


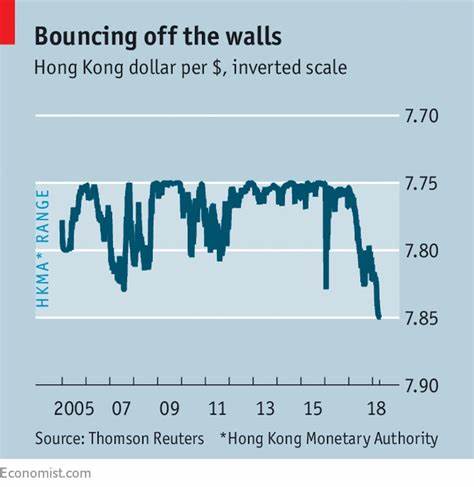
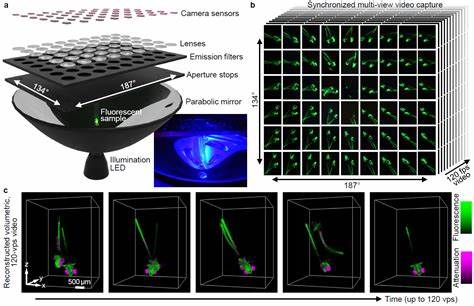
![Apple WWDC25: Platforms State of the Union [video]](/images/D4F20FF7-44FB-448C-BE90-352F3B29CD50)