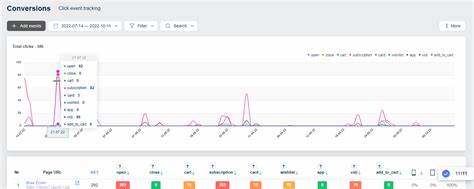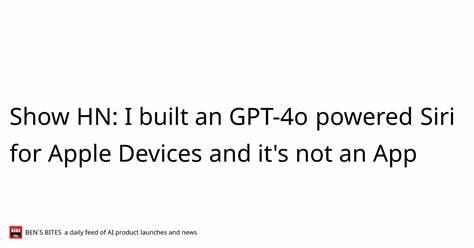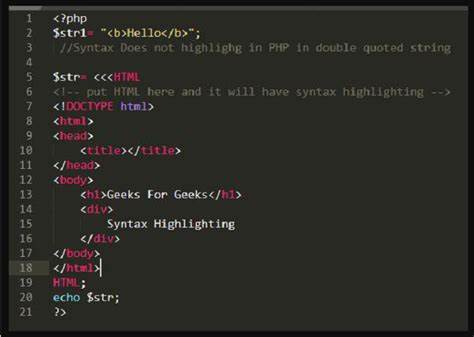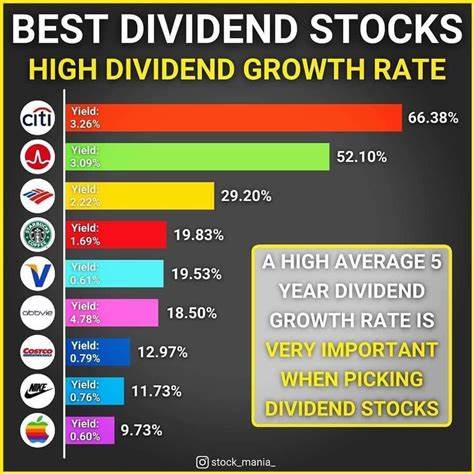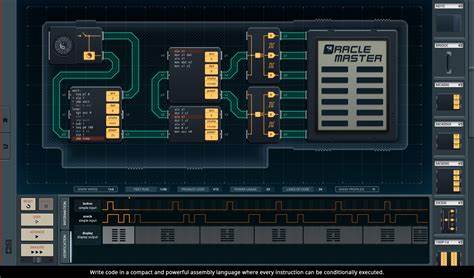Schweden hat einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen und sicheren Energiezukunft gemacht. Am 21. Mai 2025 verabschiedete das schwedische Parlament ein Gesetz zur Finanzierung der nächsten Generation von Kernreaktoren. Das Ziel dieses Gesetzes ist klar: den Ausbau einer energiepolitischen Infrastruktur sicherzustellen, die nicht nur zuverlässig und fossile Brennstoffe vermeidet, sondern auch die deutschen und europäischen Klimaziele unterstützt. Diese Entscheidung spiegelt den dringenden Bedarf Schwedens wider, eine stabile, günstige und umweltfreundliche Stromversorgung für die kommenden Jahrzehnte zu garantieren.
Die schwedische Regierung plant entweder vier großskalige Kernreaktoren mit einer installierten Kapazität von rund 5.000 Megawatt oder das entsprechende Volumen in modularen Kleinreaktoren (Small Modular Reactors – SMRs). Die Hälfte dieser Kapazität soll bereits bis zum Jahr 2035 einsatzbereit sein. Diese ehrgeizige Zielsetzung zeigt den starken Willen Schwedens, seine Energieproduktion auf innovative und gleichzeitig bewährte Technologien zu stützen, um die wachsende Nachfrage nach Strom zu decken und dabei die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Die Rolle der Kernenergie in Schweden ist historisch bedeutsam.
Seit mehreren Jahrzehnten versorgt das Land seine Bürger und die Industrie nahezu komplett durch fossilfreie Energiequellen. Wasserkraft liefert etwa 40 Prozent der Stromproduktion, die Kernenergie trägt etwa 30 Prozent bei, und Windenergie deckt ungefähr 20 Prozent des Bedarfs. Die Kernkraftwerke, die derzeit in Betrieb sind, stammen größtenteils aus den 1970er und 1980er Jahren. Um diesen Zustand zu erhalten und auszubauen, ist eine Modernisierung der Kerntechnologie unumgänglich. Vor dem Hintergrund eines prognostizierten Anstiegs der Stromnachfrage auf rund 300 Terawattstunden in den nächsten zwanzig Jahren stellt sich heraus, dass erneuerbare Energien wie Wind und Solar allein nicht ausreichen werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Das bezieht sich vor allem auf die konstant hohe Verfügbarkeit von Strom, die für die Entwicklung neuer Sektoren wie grünen Stahl, Biokraftstoffe und großskalige Wasserstoffproduktion essenziell ist. Ohne eine verlässliche und vorhersehbare Energiequelle könnte die Produktion dieser Schlüsselindustrien in andere Länder abwandern, was erhebliche negative wirtschaftliche und ökologische Konsequenzen hätte. Ebba Busch, Schwedens Energieministerin und Vizepremierministerin, betonte in ihren Statements auf Social-Media-Kanälen die Notwendigkeit einer stabilen und fossilenfreien Stromversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen. Sie sieht in der Kernenergie ein Fundament zur Unterstützung nachhaltigen Wachstums, zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes und zur Gewährleistung, dass schwedische Familien jeden Tag zu einem angemessenen Preis mit Strom versorgt werden können. Diese Argumentation ist besonders relevant in einer Zeit, in der die Energiepreise global stark schwanken und die Versorgungssicherheit durch geopolitische Unsicherheiten zunehmend infrage gestellt wird.
Trotz der großen Zustimmung innerhalb der Regierungskoalition stieß das Gesetz auf Widerstand von Seiten der Opposition. Kritik kam vor allem von der Linken Partei, die die Kosten für den Ausbau der Kernenergie als zu hoch und zeitintensiv einschätzt und argumentiert, dass Wind- und Solarenergie die einzige nachhaltige und kurzfristig verfügbare Lösung seien, um den wachsenden Energiebedarf zu decken. Birger Lahti von der Linkspartei bezeichnete das Bestreben der Regierung, den Ausbau der Kernenergie voranzutreiben, als eine Art „religiösen Glauben“, der jegliche Vernunft in Bezug auf Kosten und Effizienz überlagere. Ein weiteres Thema, das noch Klärung benötigt, ist die Frage der Finanzierung. Die Regierung teilte keine konkreten Zahlen zur Gesamtkostenschätzung oder zur Verteilung der finanziellen Last auf die Verbraucher mit.
Ein im Vorjahr veröffentlichter Weißbuchentwurf skizzierte jedoch ein mögliches Finanzierungsmodell, bei dem der Staat den Kernenergieentwicklern zwischen 300 und 600 Milliarden Kronen (ca. 31 bis 62 Milliarden US-Dollar) als Darlehen bereitstellt. Preisgarantien für den produzierten Strom sollen über einen Zeitraum von 40 Jahren bestehen bleiben, um Investitionssicherheit zu gewährleisten. Die Frage der Investitionsentscheidung bleibt zudem spannend. Vattenfall, Schwedens staatliches Energieunternehmen, hat die bislang fortschrittlichsten Pläne für moderne Kernreaktoren vorgelegt, jedoch angekündigt, erst gegen Ende dieses Jahrzehnts eine finale Investitionsentscheidung treffen zu wollen.
Dies zeigt die Komplexität des Vorhabens, vor allem angesichts der politischen Unsicherheiten aufgrund bevorstehender Wahlen im nächsten Jahr. Das neue Gesetz verdeutlicht Schwedens Engagement in einer Politik der Diversifizierung und Modernisierung seiner Energiequellen. Die gleichzeitige Förderung von großskaligen Reaktoren und modularer Kleinreaktortechnologie ist ein Versuch, unterschiedliche technologische Optionen offen zu halten. SMRs bieten aufgrund ihrer geringeren Bauzeiten und skalierbaren Kapazitäten besonders für Länder mit begrenzter Netzkapazität oder spezifischen lokalen Anforderungen eine attraktive Alternative. Damit positioniert sich Schweden an vorderster Front in der Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Kerntechnologien, die auch international hohe Relevanz besitzen.
Die Energiebranche beachtet dieses Vorhaben mit großem Interesse, denn es könnte eine Blaupause für andere europäische Länder sein, die ebenfalls auf der Suche nach Lösungen für eine nachhaltige und sichere Energiezukunft sind. Der Vorstoß Schwedens ergänzt die globale Debatte über die Rolle der Kernenergie im Spannungsfeld zwischen Klimaschutz, technologischem Fortschritt und ökonomischer Machbarkeit. Schweden unterstreicht mit diesem Gesetz die Notwendigkeit einer ausgewogenen Energiepolitik, die sowohl erneuerbare Energien als auch stabile Grundlastkapazitäten einbezieht. Gerade in Zeiten von sinkenden Kohle- und Gasnutzungen und der wachsenden Bedeutung grüner Technologie kann die Kernenergie eine tragende Säule sein, um die ambitionierten Klimaziele zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Langfristig profitieren nicht nur die schwedischen Verbraucher von einer zuverlässigen Stromversorgung, sondern auch die Industrie, die zunehmend auf nachhaltige Energie angewiesen ist, um ihre Produktionsprozesse klimafreundlich zu gestalten.
Vor allem Branchen, die auf Energieintensität angewiesen sind, könnten mit den neuen Kernreaktoren ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende leisten. Insgesamt macht Schweden mit dem neuen Gesetz deutlich, dass Kernenergie trotz der Herausforderungen in Bauzeit und Investitionsvolumen ein unverzichtbarer Baustein für eine klimaneutrale und energieintensive Zukunft ist. Die Balance zwischen Innovation, Ökonomie und Umweltschutz wird dabei kontinuierlich weiterentwickelt. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie effektiv Schweden diese Vision in die Realität umsetzen kann und welche Impulse daraus für den europäischen und globalen Energiemarkt entstehen.