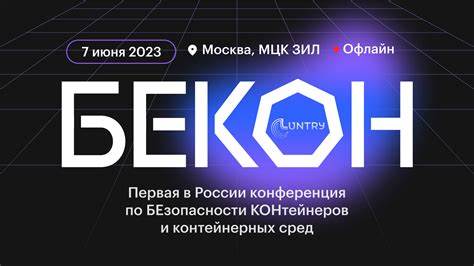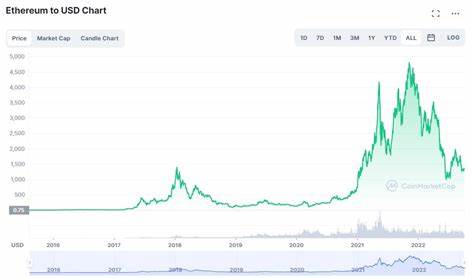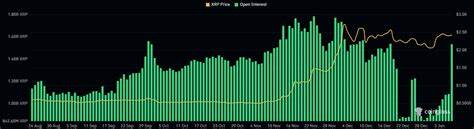In der heutigen digitalen Welt nehmen Internetanbieter eine Schlüsselrolle ein, wenn es um die Bereitstellung stabiler und sicherer Vernetzungsdienste geht. Gerade deshalb ist es unabdingbar, regelmäßig umfassende Sicherheitstests, sogenannte Penetrationstests, durchzuführen. Sie dienen dazu, Schwachstellen zu identifizieren, bevor Angreifer diese ausnutzen können. Die Geschichte eines kürzlich durchgeführten Penetrationstests bei einem großen russischen Internetprovider illustriert anschaulich, wie eine clever zusammengesetzte Reihe gegebener, eigentlich bekannte Sicherheitslücken dennoch zu einer vollständigen Kompromittierung der Infrastruktur führen kann. Dieser Erfahrungsbericht illustriert, worauf es bei solchen Tests ankommt, welche klassischen Fehler immer noch häufig vorkommen und wie durch ihre Kombination erhebliche Risiken entstehen können.
Die ersten Schritte jeder Sicherheitsüberprüfung umfassen eine gründliche Aufklärung und Informationssammlung. In diesem Fall startete der Test mit der Analyse eines relativ kleinen, klar umrissenen Infrastruktursegments, bestehend aus neun öffentlichen IP-Adressen. Obwohl dieser Umfang auf den ersten Blick bescheiden wirkt, zeigt die Praxis regelmäßig, dass selbst ein begrenzter Betrachtungsbereich ausreichend sein kann, um kritische Schwachstellen zu entdecken. Die Scans griffen zunächst gezielt Standard-HTTP- und HTTPS-Ports ab, was eine grundsätzliche Kartierung der verfügbaren Web-Dienste ermöglichte und die Angriffsfläche umriss. Bei der anschließenden Subdomain-Erkennung, die das Potenzial bietet, versteckte oder weniger offensichtliche Architekturbestandteile sichtbar zu machen, kamen automatisierte Tools zum Einsatz, die ihren Input intelligent verknüpfen, um umfangreiche Domainsammlungen zu ermitteln.
Überraschend offenbarten sich mehrere Subdomains, die zum Teil identische IP-Adressen teilten und unterschiedlich ausgerichtete Webapplikationen hosteten. Besonders auffällig war die Präsenz einer firmeneigenen ERP-Anwendung, die nicht nur auf einem Hauptknoten lief, sondern quasi vervielfältigt an Standorten in verschiedenen Städten, was deren strategische Bedeutung illustrierte. Der erste fundierte Hinweis auf eine Schwachstelle zeigte sich bei der Untersuchung der auf einem der Subdomains zugänglichen Nginx-Konfigurationsdatei. Dabei fiel eine Rewrite-Regel ins Auge, die URL-Pfade mit einem Dateiparameter verknüpfte und den Verdacht auf eine mögliche Directory Traversal bzw. Local File Read Schwachstelle hervorrief.
Eine tiefergehende Analyse ergab, dass Anfragen direkt an das zugrundeliegende PHP-Skript gesendet werden konnten, wodurch sich beliebige Dateien lesend einsehen ließen – stets mit den Rechten des Webservers. Diese Erkenntnis eröffnete zum ersten Mal die Möglichkeit, intern sensible Konfigurationsstrukturen offenzulegen und damit den Grundstein für weitere Eskalation zu legen. Im weiteren Verlauf wurden durch das Auslesen von Konfigurationsdateien unentdeckte Subdomains zutage gefördert, die zuvor weder über DNS-Recherche noch herkömmliche Scans ermittelbar waren. Darunter befand sich ein Knotenpunkt, der zusätzliche, speziell entwickelte Applikationen beherbergte. Diese waren zwar zunächst ungesichert erreichbar, doch durch gezielte Nachforschungen und Anwendung verschiedener Angriffsmethoden ließen sich auch hier Schwachstellen aufdecken.
Das Zusammenspiel aus sicheren und unsicheren Zugangspunkten spiegelte die Realität vieler Unternehmensumgebungen wider, in denen unterschiedliche Entwicklungsstandards und Sicherheitsprozesse parallel existieren. Eine innere Eigenentwicklung wie die ERP-Lösung hatte dabei einen entscheidenden Nachteil: Im Gegensatz zu verbreiteten Standardprodukten wurde sie nur unregelmäßig getestet, sodass einfache klassische Fehler wie fehlende Inputvalidierung, unsaubere Authentication-Mechanismen und unzureichende Zugriffskontrollen selten erkannt und behoben wurden. Auf Basis der lesbaren Dateien konnten Verbindungsdatenbanken, interne API-Endpunkte und weitere wertvolle Informationen extrahiert werden. So wurde es möglich, sich eine weiterführende Zugangsstufe zu schaffen und über die API-Anbindungen mit erweiterten Befehlen direkt auf die Backend-Services zuzugreifen. Auch hier führten ungeprüfte Parameterübergaben zu gravierenden Schwachstellen wie Remote Code Execution.
Das stetige Fortschreiten entlang der gefundenen Schwachstellen verdeutlichte exemplarisch, wie durch das Verkettungspotenzial einzelner, vermeintlich harmloser Fehler eine verheerende Sicherheitslücke entstehen kann. Besonders die Kombination aus Directory Traversal, mangelnder Authentifizierung, schlecht gesicherten internen APIs und fehlenden Netzwerksegmentierungen bereitete den Boden für eine vollständige Systemübernahme. Dieser Fall unterstreicht, dass eine bloße Kenntnis einzelner Angriffstechniken und Schwachstellen nicht ausreicht. Entscheidend ist die Fähigkeit, sie in einem umfassenden Zusammenhang zu analysieren, ihre Auswirkungen zu bewerten und Gegenmaßnahmen strategisch zu planen. Penetrationstester müssen daher sowohl technische Expertise als auch unternehmerisches Verständnis mitbringen, da nur so Risiken richtig eingeschätzt und priorisiert werden können.
Die Lehren aus diesem erfolgreichen Angriffsszenario sind vielfältig. Moderne Systeme müssen konsequent durch mehrstufige Sicherheitsprüfungen begleitet werden, die sowohl White- als auch Black-Box-Methoden umfassen. Insbesondere selbst entwickelte Applikationen benötigen ein erhöhtes Augenmerk, da standardisierte Sicherheitsupdates und Marktfeedback hier oft fehlen. Außerdem sind regelmäßige Code-Reviews, automatisierte Scans und Schulungen der Entwickler essenziell, um einfache Fehler schon im Entstehungsprozess zu minimieren. Weiterhin verdeutlicht das Beispiel, wie essenziell eine klare Netzsegmentierung und Rollenvergabe bei Zugriffsrechten ist.
Selbst wenn einzelne Komponenten kompromittiert werden, sollte dies nicht automatisch die komplette Infrastruktur in Gefahr bringen. Implementierte Schutzschichten wie Web Application Firewalls und konsequente Protokollierungen bieten zusätzliche Sicherheitsebenen. Zusammenfassend zeigt der Penetrationstest, dass auch in hochkomplexen Infrastrukturen die grundlegend klassischen Sicherheitslücken nach wie vor existieren und ausgenutzt werden können – häufig aufgrund von Unachtsamkeit, Zeitdruck oder fehlendem Sicherheitsbewusstsein. Die Abfolge und smarte Kombination dieser Schwachstellen erzeugen eine Bedrohung, die ein schnelles und tiefgreifendes Eindringen sowie Kontrolle über kritische Systeme ermöglicht. Für Unternehmen und Provider heißt dies, dass neben der Installation modernster Sicherheitswerkzeuge vor allem das Verständnis für die Zusammenhänge und die Stärkung der Sicherheitskultur im Betrieb essenziell sind.
Nur so lassen sich Angriffe effektiv verhindern und die Vertraulichkeit, Integrität sowie Verfügbarkeit der Dienste langfristig gewährleisten.