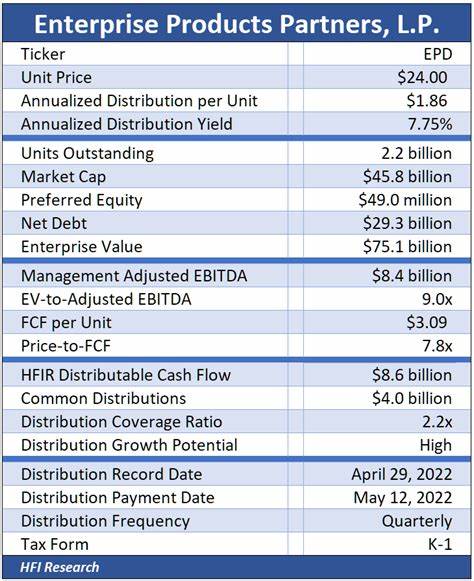Die Suche nach den Ursprüngen des Wassers im Universum ist ein zentraler Bestandteil moderner Astronomie und Astrophysik. Wasser, das für das Leben auf der Erde unverzichtbar ist, besitzt eine komplexe Geschichte, die weit zurückreicht, oft sogar vor die Entstehung unseres eigenen Sonnensystems. Eine bahnbrechende Entdeckung, die kürzlich von einem internationalen Forscherteam gemacht wurde, trägt maßgeblich zu unserem Verständnis bei: semi-schweres Wassereis wurde erstmals rund um einen jungen, sonnenähnlichen Stern nachgewiesen. Diese Erkenntnis gibt Hinweise darauf, dass ein großer Teil des Wassers in unserem Sonnensystem bereits in den dunklen, kalten Wolken existierte, aus denen Sterne und Planetensysteme entstehen. Semi-schweres Wasser, auch HDO genannt, unterscheidet sich von gewöhnlichem Wasser (H2O) durch die Substitution eines der Wasserstoffatome durch Deuterium, ein schwereres Isotop des Wasserstoffs.
Deuterium entsteht unter besonderen Bedingungen, deren Nachweis in der Zusammensetzung von Wasser wichtige Rückschlüsse auf die Herkunft und die physikalischen Eigenschaften des Wassers erlaubt. Dabei ist der sogenannte Deuterationsgrad, also das Verhältnis von HDO zu H2O, ein entscheidender Faktor. Ein höherer Anteil an semi-schwerem Wasser wird üblicherweise mit der Bildung von Wasser in besonders kalten Umgebungen in Verbindung gebracht, wie etwa den dunklen interstellaren Wolken aus Staub, Eis und Gas, in denen Sterne geboren werden. Für die aktuelle Studie wurde mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) die protostellare Hülle eines jungen Sterns, L1527 IRS, untersucht. Dieser Stern befindet sich etwa 460 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Stier und befindet sich noch im Anfangsstadium seiner Entwicklung, ähnlich wie unser eigenes Sonnensystem zu Beginn seiner Entstehung.
Mit der hochsensiblen Spektroskopie des JWST konnten die Forschenden erstmals eine klare Signatur von semi-schwerem Wassereis im Eisspektrum dieses Protosterns zweifelsfrei nachweisen. Das Spektrum zeigte eindeutige Merkmale von HDO-Eis, die vorherige Beobachtungen nicht in vergleichbarer Qualität hatten. Das erzielte Verhältnis von HDO zu H2O im Eis um L1527 ist sehr ähnlich zu den Verhältnissen, die man in Kometen sowie in protoplanetaren Scheiben junger Sterne misst. Das deutet darauf hin, dass das Wasser, das sich später in Planeten und Kometen ansammelte, schon während der frühen kalten Phasen der Sternentstehung vorhanden war. Das unterstützt die Hypothese, dass das Wasser in unserem eigenen Sonnensystem zum Großteil unverändert von den ursprünglichen interstellaren Wolken in die Planeten und Monde eingebracht wurde.
Interessanterweise ist das Verhältnis von semi-schwerem Wasser in L1527 IRS leicht höher als die Werte, die in einigen Kometen und auch auf der Erde gemessen werden. Dies könnte mehrere Ursachen haben. Zum einen könnten chemische Umwandlungen und Prozesse in der protoplanetaren Scheibe, die die Entstehung der Planeten begleitete, das Deuteriumverhältnis verändert haben. Zum anderen könnte die dunkle Wolke, aus der unser Sonnensystem hervorging, sich in ihrer chemischen Zusammensetzung von jener um L1527 unterschieden haben. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um diese Unterschiede zu verstehen und mehr über die Geschichte des Wassers in verschiedenen Sternentstehungsgebieten zu erfahren.
Die Entdeckung der semi-schweren Wasserisotope leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Debatte über die Herkunft von irdischem Wasser. Lange Zeit war unklar, ob das Wasser auf der Erde durch Kometen und Asteroiden eingebracht wurde oder ob es bereits auf dem frühen Planeten vorhanden war. Die Ähnlichkeiten der Deuteriumverhältnisse von HDO in L1527, Kometen und der Erde verstärken die Annahme, dass Wasser im Sonnensystem über lange Zeiträume und verschiedene Phasen hinweg relativ konserviert blieb. Das gibt Hinweise darauf, dass das Prinzip der Wasserweitergabe von frühen interstellaren Wolken bis zu planetaren Systemen ein universeller Prozess sein könnte. Die Studie ist zudem ein Paradebeispiel für die Leistungen moderner Weltraumteleskope und Spektroskopietechnologien.
Vor dem Start des JWST war das Messen des Deuteriumanteils bei Wasser vor allem in gasförmigen Molekülen möglich, deren Zusammensetzung aber durch wechselnde chemische Prozesse oft verfälscht wird. Mit den neuen Instrumenten ist es nun erstmals möglich, den Eisanteil direkt zu beobachten und so präzisere Aussagen über die ursprüngliche chemische Zusammensetzung der molekularen Wolken, aus denen Sterne entstehen, zu treffen. Das Team plant bereits umfassendere Untersuchungen: In weiteren Beobachtungen sollen bis zu 30 weitere Protosterne und dunkle Wolken auf das Vorhandensein und die Häufigkeit von HDO untersucht werden. Gleichzeitig werden ergänzende Messungen mit bodengestützten Observatorien, wie dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), durchgeführt, um den deuterierten Wasserdampf in denselben Objekten zu erfassen. Diese Kombination soll helfen, die räumliche Verteilung und Entwicklung des semi-schweren Wassers besser zu verstehen und die Prozesse der Wasserentstehung und -weitergabe im Detail zu rekonstruieren.
Das Verständnis der Wasserursprünge hat weitreichende Konsequenzen für die Astrobiologie und die Suche nach Leben in anderen Planetensystemen. Wasser ist die Grundlage für Leben, wie wir es kennen, und die Wissenszunahme über seine Verteilung, Entstehung und Erhaltung über kosmische Zeiten hinweg gibt wichtige Hinweise darauf, wo lebensfreundliche Bedingungen außerhalb des Sonnensystems existieren könnten. Die Tatsache, dass semi-schweres Wassereis in einer protostellaren Phase nachgewiesen werden konnte, legt nahe, dass lebenswichtige Materialien früh und weit verbreitet im Universum vorhanden sind. Zusammenfassend zeigt der erste sichere Nachweis von semi-schwerem Wassereis um einen jungen, sonnenähnlichen Stern die starke Verbindung zwischen Wasser im interstellaren Medium und jenem, das schlussendlich Planeten wie der Erde zugutekommt. Diese Entdeckung unterstützt die Idee, dass Wasser bereits in sehr frühen Stadien der Sternentstehung gebildet wurde und relativ unverändert bis zum Sonnenplanetensystem überdauert hat.
Die Kombination neuester technologischer Instrumente und interdisziplinärer Forschung öffnet neue Türen, um die komplexe Geschichte des Wassers im Kosmos weiter zu entschlüsseln und bietet spannende Perspektiven für zukünftige Forschungen in Astronomie und Astrobiologie.