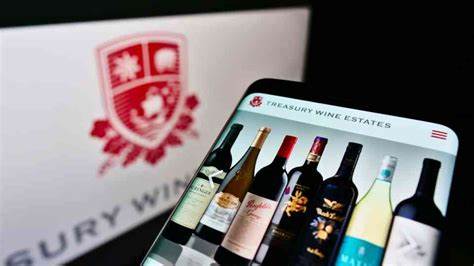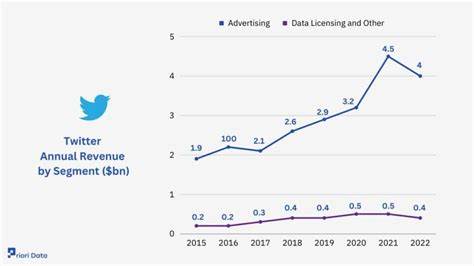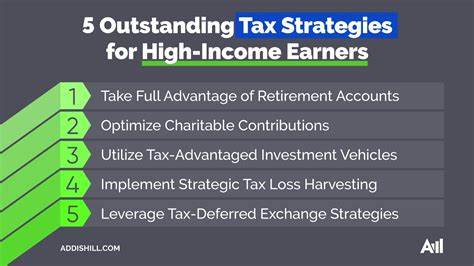Die Sicherheit von Webanwendungen ist in der heutigen digitalen Welt von zentraler Bedeutung. Immer mehr Unternehmen setzen auf webbasierte Lösungen, um mit Kunden zu interagieren, Geschäfte abzuwickeln oder interne Abläufe zu optimieren. Mit der steigenden Verbreitung wachsen allerdings auch die Bedrohungen durch Cyberangriffe. Umso wichtiger ist es, dass die Sicherheit von Applikationen regelmäßig und gründlich getestet wird. Aber ist die Sicherheit einer Webanwendung überhaupt immer testbar? Und worauf müssen Unternehmen achten, wenn sie die Schutzmechanismen ihrer Anwendungen überprüfen wollen? Das Testen der Sicherheit einer Webanwendung ist eine komplexe Herausforderung.
Es gibt viele verschiedene Aspekte, die bedacht werden müssen, angefangen bei der Infrastruktur über den Anwendungscode bis hin zu den eingesetzten Sicherheitsmechanismen. Grundlegende Informationen und Standards können beispielsweise bei der OWASP Foundation gefunden werden, die wichtige Sicherheitsrisiken und Schutzmaßnahmen für Webanwendungen definiert. Im Idealfall sollte die Überprüfung der Sicherheit durch sogenannte Penetrationstests erfolgen, die von Sicherheitsexperten durchgeführt werden. Dabei wird das System gezielt nach Schwachstellen durchsucht, um mögliche Angriffsvektoren zu identifizieren. Diese Tests sind sehr effektiv, aber auch teuer und erfordern viel Fachwissen.
Die meisten Unternehmen sind nicht in der Lage, solche professionellen Penetrationstests regelmäßig für alle ihre Webanwendungen durchzuführen. Deshalb sucht die Branche nach kostengünstigeren Alternativen, die dennoch verlässliche Ergebnisse liefern. Hier setzt das Open-Source-Tool ZAP (Zed Attack Proxy) an, das eine automatisierte Sicherheitsüberprüfung von Webanwendungen ermöglicht. ZAP ist erschwinglich, einfach in der Anwendung und lässt sich bei Bedarf immer wieder einsetzen, um Schwachstellen aufzudecken. Dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass auch ZAP nur so gut fungieren kann, wie es die Testumgebung und die Anwendung selbst zulassen.
Künstliche Hürden im Testprozess können das Screening erschweren und die resultierenden Sicherheitseinschätzungen verfälschen. Statt die Sicherheit zu erhöhen, können solche Barrieren im schlimmsten Fall das Risiko erhöhen, weil Angreifer oft flexibler und kreativer sind als automatisierte Tools. Eine der Vorbedingungen für ein effektives Sicherheitstest-Setup ist die Provisionierung einer gesonderten Testumgebung. Das bedeutet, dass die Webanwendung und alle zugehörigen Dienste in einer isolierten Umgebung eingerichtet werden müssen, ohne dass manuelle Eingriffe während der Tests notwendig sind. Diese Umgebung sollte alle Funktionalitäten enthalten, die für ein realistisches Testen erforderlich sind, einschließlich verschiedener Testdaten und Benutzer für unterschiedliche Zugriffsrollen.
Ein häufiges Problem ist, dass manche Systeme auf externe Dienste angewiesen sind, die nicht in der Testumgebung simuliert werden können. Wenn das der Fall ist, lassen sich verlässliche und reproduzierbare Testergebnisse nur schwer erzielen. Darüber hinaus spielt die Performance der Testumgebung eine entscheidende Rolle. Ein langsamer oder instabiler Testserver kann dazu führen, dass Tools wie ZAP Schwierigkeiten haben, Inhalte zu laden oder korrekt zu analysieren. Zeitüberschreitungen bei Anfragen können dazu führen, dass potenzielle Sicherheitslücken übersehen werden.
Zwar gibt es Möglichkeiten, ZAP für solche Situationen zu konfigurieren, doch dieser Vorgang erfordert manuelle Anpassungen, die von vielen Anwendern möglicherweise nicht erkannt werden. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der automatisierten Sicherheitsprüfung ist die Handhabung von Authentifizierungsmechanismen. Viele Webanwendungen nutzen komplexe Login-Verfahren oder mehrstufige Authentifizierungen, was die automatisierte Anmeldung durch ZAP erschwert. Obwohl das Tool eine breite Palette von Authentifizierungsmethoden unterstützt, steigt der Konfigurationsaufwand mit zunehmender Komplexität. Wenn ZAP sich nicht erfolgreich authentifizieren kann, ist es nicht in der Lage, tiefere Bereiche der Webanwendung zu prüfen, was die Aussagekraft des gesamten Tests einschränkt.
Die Fähigkeit von ZAP, die Anwendung zu erkunden und Inhalte zu erfassen, hängt stark von der Architektur und dem Design der Webanwendung ab. Während Links in HTML-Dokumenten für automatisierte Spider einfach zu erfassen sind, stellen interaktive Elemente wie Event-Handler auf DIV-Elementen oder Popup-Menüs größere Herausforderungen dar. Die AJAX-Spider von ZAP beispielsweise haben häufig Schwierigkeiten mit dynamischen Komponenten wie Popups. Es zeigt sich immer wieder, dass Webanwendungen, die strikt auf menschliche Nutzer ausgerichtet sind, nicht unbedingt für automatisierte Analysewerkzeuge optimiert sind. Regelmäßige automatische Abmeldungen oder Weiterleitungen zur Login-Seite erschweren zudem das Crawlen.
Da die bestehenden ZAP-Spider derzeit keine Shadow DOMs erkennen können, bleiben ebenfalls Lücken bei der Abdeckung. Ein hilfreicher Ansatz, um die Reichweite der Tests zu erhöhen, besteht darin, Integrationstests über ZAP zu proxyen. So kann man sicherstellen, dass auch komplexe Abläufe und Funktionalitäten mit in die Sicherheitsbewertung einfließen. Für Webanwendungen mit APIs ist es von Vorteil, wenn diese über automatisch gepflegte API-Definitionen verfügen. API-Schnittstellen lassen sich so besser in die automatisierte Sicherheitsprüfung integrieren und Schwachstellen gezielter aufdecken.
Viele der von ZAP unterstützten API-Standards und deren Importmöglichkeiten sind ausführlich dokumentiert. Ein großer Stolperstein sind Sicherheitsmechanismen, die speziell dafür ausgelegt sind, automatisierte Zugriffe zu verhindern. Dazu zählen CAPTCHAs, Multi-Faktor-Authentifizierung, Web Application Firewalls, kurze Session-Timeouts, Einschränkungen bei aktiven Sitzungen pro Benutzer oder dynamische Veränderung von Feldbezeichnern. Diese Kontrollen sind sinnvoll und notwendig im produktiven Betrieb, um Angreifer zu blockieren. Für den Einsatz in der Testumgebung sollten sie jedoch möglichst deaktiviert oder zumindest reduziert werden, da sie das automatisierte Testen erheblich erschweren und so zu weniger aussagekräftigen Ergebnissen führen.
Darüber hinaus erschweren auch UI-Komponenten, die zur Interaktion mit Nutzern erstellt wurden, automatisierte Tests. Elemente wie zwingende Zustimmungserklärungen, Popups für Newsletter-Anmeldungen oder andere Dialogfenster sollten in der Testumgebung ohne Aufwand abgeschaltet werden können. Andernfalls behindern sie die automatisierte Navigation und vermindern die Effektivität von Tools wie ZAP. Spezielle Herausforderungen ergeben sich auch durch die Integration von Messaging- oder Kommunikationsfunktionen innerhalb der Webanwendung. Systeme wie Rückmeldungsformulare oder Chatbots erzeugen oft eine Vielzahl von Textnachrichten oder anderen Kommunikationsereignissen, die während der automatisierten Scans entstehen können.
Um unerwünschte „Spam“-Nachrichten zu vermeiden, sollten diese Komponenten idealerweise deaktiviert oder isoliert sein, ohne dass dadurch potenzielle Sicherheitslücken verborgen bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Testbarkeit der Sicherheit von Webanwendungen stark davon abhängt, inwieweit die Anwendung und ihre Umgebung für automatisierte Tools vorbereitet sind. Ein wohlüberlegtes Setup, das eine stabile, realitätsnahe und frei von störenden Sicherheitsmechanismen konfigurierte Testumgebung bereitstellt, ist unabdingbar. Werkzeuge wie ZAP leisten dabei wertvolle Dienste, indem sie kostengünstig und flexibel Schwachstellen aufdecken können. Dennoch dürfen Unternehmen nicht darauf vertrauen, dadurch hundertprozentige Sicherheit zu erreichen.
Automatisierte Prüfungen sind ein wichtiger Bestandteil eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts, das durch regelmäßige manuelle Penetrationstests, Code-Reviews und ein durchdachtes Sicherheitsmanagement ergänzt werden muss. Nur durch ein Zusammenspiel dieser Maßnahmen kann die Sicherheit von Webanwendungen nachhaltig gewährleistet werden.