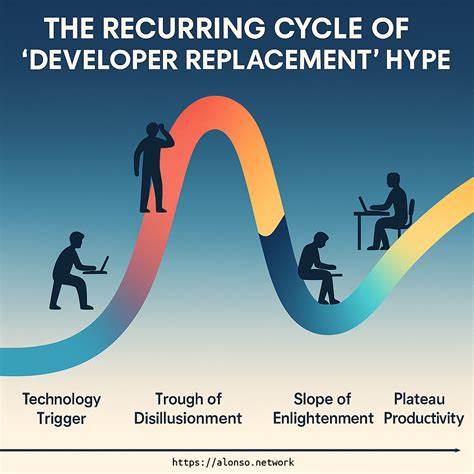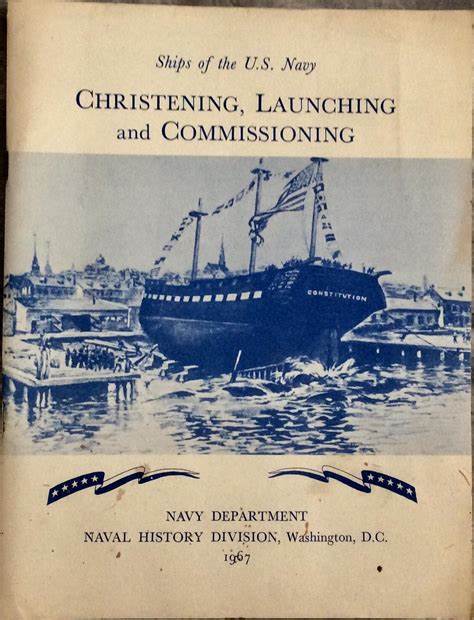Ostgalizien, eine historisch vielfältige Grenzregion im heutigen Westukraine, war im Verlauf des Zweiten Weltkriegs Schauplatz extremer Gewalt und massenhafter ethnischer Säuberungen. Diese Region mit ihrer komplexen ethnischen Zusammensetzung – hauptsächlich Ukrainer, Polen und eine bedeutende jüdische Minderheit – erlebte eine Kontinuität multipler Gewaltexzesse, die nicht zuletzt zivile Bewohner tiefgreifend traumatisierten. Die multidimensionale Natur dieser Traumata geht über individuelle Erfahrungen hinaus und umfasst kollektive und gesellschaftliche Ebenen, die noch Jahrzehnte nach Kriegsende nachwirken. Die massiven sozialen und ethnischen Umwälzungen in Ostgalizien machten es nahezu unmöglich für die Bewohner, sich dem Geschehen zu entziehen. Die Nähe der Gewalt, sowohl räumlich als auch sozial, führte dazu, dass die Grenzen zwischen Zeugen, Opfern, Unterstützern und Tätern vielfach verschwammen.
Dieses Einbezogen-Sein – oder besser gesagt, das Gefangensein in einem Netz wechselnder Rollen – stellte die Menschen vor psychologische Herausforderungen, die traditionell nur schwer in Kategorien von Täter-Opfer-Dichotomien passen. Vor Kriegsausbruch war Ostgalizien eine multiethnische Region mit dynamischen Lebensgemeinschaften, in denen zum Teil enge nachbarschaftliche Beziehungen bestanden. Mit dem Einmarsch der Sowjetunion 1939 begann eine Phase brutaler politischer Repressionen, unter anderem Deportationen und Massenmorde an polnischen Eliten. Die darauffolgende deutsche Besatzung löste den Holocaust aus, der die jüdische Bevölkerung systematisch auslöschte. Parallel zu diesen Grausamkeiten kam es zu ethnischen Säuberungen zwischen Ukrainern und Polen mit zehntausenden Toten, begleitet von Vergeltungsaktionen.
Zuletzt entbrannte der Kampf zwischen sowjetischen Kräften und der ukrainischen Aufständischen Armee, wodurch die Gewaltspirale ihre Fortsetzung fand. Die unmittelbare Konfrontation mit äußerster Gewalt bedeutete für die Bewohner ein unablässiges Leben im Schatten des Todes und des Verlusts. Zeugnisse berichten von menschenunwürdiger Demütigung, Morden vor den Augen der Nachbarschaft und der täglichen Begegnung mit Leichen und Massengräbern. Kinder, Erwachsene und Alte waren gezwungen, diese Szenerien mit anzuschauen, teilweise sogar aktiv in Hilfsrollen eingebunden – etwa beim Vergraben von Opfern oder beim Transport der Ermordeten. Diese erzwungene Verstrickung führte zu einer tiefgreifenden seelischen Belastung, die in vielen Fällen traumatische Manifestationen hervorbrachte.
Psychologisch betrachtet lassen sich die Erfahrungen der „verflochtenen Zeugen“ nur bedingt mit bekannten Traumakategorien fassen. Für sensiblere Individuen oder jene mit direktem Kontakt zur Gewalt entfalteten sich deutliche Symptome wie Angstzustände, Schlaflosigkeit, psychosomatische Beschwerden und wiederkehrende Alpträume. Doch nicht nur die unmittelbare Konfrontation mit Tod und Gewalt hinterließ Spuren. Die anhaltende Angst vor erneuten Angriffen – die ständige Bedrohung des eigenen Lebens und des familiären Umfelds – prägte die gesamte Lebensrealität nachhaltig. Zudem wurde ein Gefühl generalisierter Angst über die gesamte Gemeinschaft verbreitet, das nicht immer rational erklärbar war, aber unermessliche weitere Belastungen verursachte.
Neben diesen individuellen Traumafolgen entstand jedoch ein kollektives Trauma, das sich aus dem Verlust von Familienangehörigen, Nachbarn und sozialen Netzwerken speiste. Der völlige Zusammenbruch stabiler sozialer Strukturen, das Verschwinden ganzer Bevölkerungsgruppen und die Zerrüttung nachbarschaftlicher Vertrauen führten zu einer traumatisierten Gemeinschaft, die um ihre Existenz als intakte gesellschaftliche Einheit rang. Dieses kollektive Trauma manifestierte sich auch in ökonomischer und kultureller Hinsicht: Berufe, Handel und Bildungswesen wurden durch das Fehlen von Ärzten, Lehrern, Handwerkern und Kaufleuten massiv beeinträchtigt. Ganze Ortschaften mutierten zu geisterhaften Orten, die einst blühenden Gemeinden gleichen einer entvölkerten Wüstenlandschaft. Die soziale Anomie und der Verfall moralischer Bindungen wirkten nachhaltig zerstörend auf die Gemeinschaften.
Die multiplen Erfahrungen von Gewalt, Verlust und Entwurzelung nährten auch ein Trauma der Erinnerung und des Schweigens. Das Verbot oder die Unmöglichkeit, offen über die erlittenen Traumata und die Täter zu sprechen, verstärkte die Isolation der Betroffenen nach dem Krieg. In Ostgalizien wurde Schweigen zur Überlebensstrategie und sozialen Notwendigkeit – nicht nur wegen der Angst vor Repressionen durch sowjetische Behörden, sondern auch wegen des erzwungenen Zusammenlebens mit Tätern und Mitwissern im Alltag. Das Leben „mit den Toten“ war nicht nur metaphorisch, sondern oftmals eine konkrete Realität. Massengräber, viele davon unbekennzeichnet oder gar überbaut, säumten Dörfer und Städte.
Häuser von ermordeten Nachbarn wurden von Überlebenden oder Neubewohnern eingenommen. Dieses physische Umfeld konfrontierte die Überlebenden täglich mit den Spuren und der Präsenz der Gewalt, was die Traumatisierung ungebrochen aufrechterhielt. Die dauerhafte Auseinandersetzung mit dem Trauma in Ostgalizien ist dadurch gekennzeichnet, dass individuelle psychologische Belastungen, kollektives Verlustgefühl und erzwungenes Schweigen untrennbar miteinander verflochten sind. Die Komplexität der Kriegserfahrungen und der vielschichtige Umgang mit Gewalt erschweren eine einfache Erinnerungskultur und Verarbeitungsprozesse, die für eine gesellschaftliche Heilung notwendig wären. Zugleich zeigt die Forschung, dass das Trauma von Ostgalizien keine statische Größe ist.