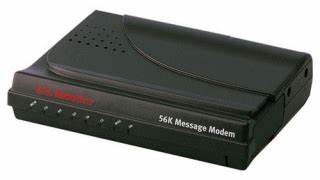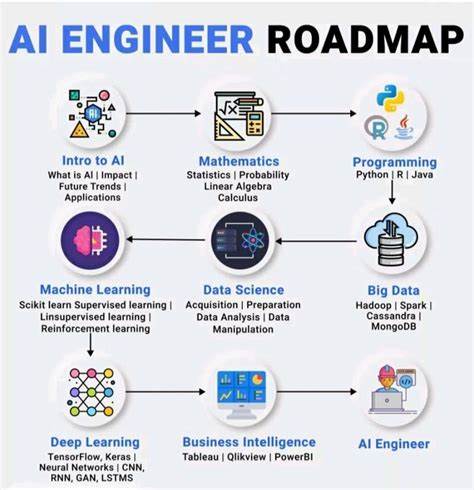Die Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China waren in den vergangenen Jahren von anhaltenden Spannungen geprägt, die sich in einem intensiven Handelskrieg widerspiegelten. Unter der Führung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wurden hohe Zölle eingeführt, die als wirtschaftliches Druckmittel dienen sollten, um China zu Zugeständnissen zu bewegen. Besonders die Einführung von bis zu 145 Prozent Zoll auf bestimmte chinesische Güter war ein bemerkenswerter Schritt, welcher auf eine aggressive Strategie hindeutete. Doch nun, mit der Ankündigung eines neuen Handelsabkommens, wird diese Strategie von Experten wie Peter Schiff scharf kritisiert. Schiff bezichtigt Washington, letztlich den Kürzeren gezogen zu haben, weil China den „Bluff“ der hohen Zölle erkannte und darauf entsprechend reagierte.
Er bezeichnet den Deal als Pyrrhussieg für die USA – ein angebliches „Gewinnen“, das in Wirklichkeit ein Nachgeben war. Peter Schiff, ein prominenter Ökonom und Verfechter einer freien Marktwirtschaft, meldete sich öffentlich über die sozialen Medien zu Wort und äußerte tiefgreifende Zweifel an der Effektivität des jüngsten Handelsabkommens. Er hinterfragt, welche Vorteile die Vereinigten Staaten tatsächlich aus der Vereinbarung ziehen, wenn die ursprünglich erhobenen Tarife von 145 Prozent auf nur 30 Prozent gesenkt wurden und die Gegenmaßnahmen Chinas ebenfalls reduziert, aber nicht aufgehoben wurden. Schiff's Fazit lautet, dass keine Seite substanzielle Zugeständnisse machte und die USA vor einem wirtschaftlichen Rückschritt stehen könnten, weil man den Konflikt frühzeitig beendet hat, ohne bedeutende Win-Win-Ergebnisse erreicht zu haben. Die Kritik von Schiff wäre alleinstehend vielleicht weniger beachtenswert, jedoch teilen viele renommierte Volkswirte seine Skepsis.
James Knightley, Chefvolkswirt bei ING, hebt in Analysen hervor, dass der Tarifdruck zwar reduziert wurde, aber weiterhin bestehen bleibt. Für produzierende Unternehmen bleibt es günstiger, in China zu fertigen statt die Produktion in die USA zurückzuführen. Dies widerspricht einem der erklärten Ziele der US-Handelspolitik: die sogenannte „Reshoring“-Strategie, die Arbeitsplätze in die eigene Volkswirtschaft zurückholen soll. So bleiben die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile eher beschränkt, da Konkurswellen und der Verlust von Arbeitsplätzen in traditionellen Industriezweigen sich nicht signifikant verringern. Ein weiterer prominenter Kritiker, Larry Summers, ehemaliger US-Finanzminister, kommentierte ebenfalls die Entwicklung auf der Plattform X (ehemals Twitter).
Summers spricht von einem „Bluff“, der von China erkannt und nicht beantwortet wurde. Er meint, es sei gut und notwendig, Karten auch mal neu zu mischen und Fehler einzugestehen, dennoch beschwört diese Entwicklung vor allem wirtschaftliche Unsicherheit herauf. Die politische Entscheidung, den Handelskrieg für vorerst drei Monate auszusetzen, signalisiere vor allem den Beginn einer Phase der Abwägung, wie weit es sich lohnt, in Strafzöllen zu verharren – oder doch Kompromisse einzugehen, auch wenn diese hinter den ursprünglichen Forderungen zurückbleiben. Die wirtschaftlichen Folgen dieses verfahrenen Stillstands sind bereits jetzt spürbar. Laut einer Studie der Budget Lab der Yale-Universität sind die effektiven Durchschnittszölle in den USA so hoch wie seit 1934 nicht mehr.
Die Leistungsverluste durch Handelshemmnisse schlagen sich in Wachstumseinbußen beim Bruttoinlandsprodukt nieder, die von Experten auf etwa 0,7 Prozent für das Jahr 2025 geschätzt werden. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosenquote um etwa 0,35 Prozent im Jahresverlauf, was auf eine weniger dynamische Beschäftigungslage hindeutet. Für Verbraucher bedeutet dies eine Teuerung von durchschnittlich 1,7 Prozent, was ihre Kaufkraft um rund 2.800 US-Dollar pro Haushalt schmälert. Diese sind erhebliche Belastungen für den US-Konsum, der traditionell als Motor der Weltwirtschaft gilt.
Auf der anderen Seite zeigt China ein geschickt kalkuliertes Verhalten. Die Volksrepublik verweist darauf, dass keine wesentlichen politischen oder wirtschaftlichen Zugeständnisse eingegangen wurden. Trotz der neuen Vereinbarungen bleibt die chinesische Führung standhaft, ihre wirtschaftlichen Ziele zu verfolgen und bleibt mit vergleichsweise niedrigen Gegenmaßnahmen im Bereich von etwa 10 Prozent Zöllen. Dies manifestiert die Position Chinas als weltweit dominante Produktionsstätte, die es versteht, mit diplomatischem und wirtschaftlichem Geschick westlichen Druck zu überstehen. Der Handelskrieg hat damit auch die langjährige Debatte um Globalisierung und wirtschaftliche Interdependenz neu entfacht.
Während Trump und seine Administration glauben, durch Druck und Protektionismus bessere Bedingungen für die eigene Wirtschaft zu schaffen, zeigt die Erfahrung, dass solche Maßnahmen mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sind. Steigende Preise, eingeschränkte Lieferketten und wachsende Unsicherheiten führen zu Kosten, die nicht nur Unternehmen, sondern vor allem die Verbraucher tragen müssen. Darüber hinaus hat der Handelskonflikt auch internationale Lieferketten nachhaltig beeinflusst. Unternehmen haben begonnen, ihre Abhängigkeit von China neu zu bewerten und alternative Standorte in anderen asiatischen Ländern oder sogar innerhalb der USA zu prüfen. Diese Verlagerungen sind aber teuer und zeitaufwendig, weshalb die vollständige Umorientierung noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird.
Die Senkung der Zölle auf vorübergehender Basis (90 Tage) gibt zwar kurzfristig etwas Raum für Anpassung, löst aber das grundsätzliche Problem der Wettbewerbsfähigkeit nicht. Insgesamt verdeutlicht die Kritik an dem US-China-Handelsdeal die komplexen Dynamiken, die internationale Handelspolitik heute prägen. Eine einfache Zuschreibung von Gewinnern und Verlierern greift zu kurz. Dennoch steht fest, dass die USA angesichts der ökonomischen Auswirkungen und der kritischen Stimmen amerikanischer und internationaler Experten eine schwierige Bilanz ziehen müssen. Die Frage, ob der neue Deal den erhofften Durchbruch markiert oder vielmehr ein verspätetes Eingeständnis eines verlorenen Handelskriegs darstellt, bleibt offen.
Für die wirtschaftlichen Perspektiven und die Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ist es jedoch ein entscheidender Moment, dessen Konsequenzen noch langfristig zu spüren sein werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China und dessen vorläufiges Ende lehrreiche Einblicke in die Auswirkungen von wirtschaftlicher Abschottung, politischen Manövern und globaler Vernetzung bietet. Die Herausforderung für die USA wird darin bestehen, geeignete Strategien zu entwickeln, die sowohl die Wettbewerbsfähigkeit stärken als auch die Interessen der Verbraucher schützen. Wohl überlegt und mit Bedacht sollten zukünftige Schritte angegangen werden, um den internationalen Handel nicht weiter zu belasten, sondern auf nachhaltige und ausgewogene Weise zu gestalten.