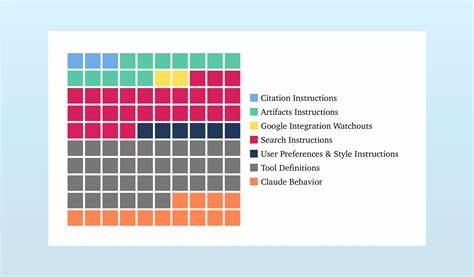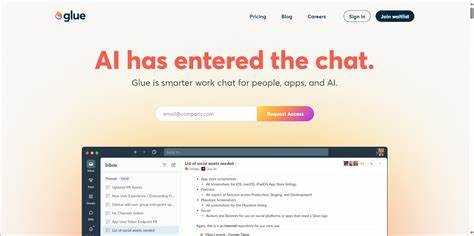Die Technologie des autonomen Fahrens gilt als eine der revolutionärsten Innovationen unserer Zeit, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, grundlegend zu verändern. Unternehmen wie Tesla und Comma.ai nehmen dabei eine prominente Position ein und versprechen eine Zukunft, in der autonome Fahrzeuge den Verkehr sicherer, effizienter und umweltfreundlicher gestalten. Doch trotz der Fortschritte gibt es einen entscheidenden Punkt, den diese Akteure im Bereich des automatisierten Fahrens bislang unterschätzt oder übersehen haben: die Bedeutung der urbanen Mobilität und die Fokussierung auf innerstädtische Umgebungen als strategischen Ausgangspunkt für die Skalierung autonomer Fahrzeuge.Tesla hat vor einigen Jahren mit seinem Autopilot für viel Aufsehen gesorgt und wurde von vielen als Vorreiter für die breite Einführung selbstfahrender Autos gefeiert.
Elon Musk, Tesla's CEO, äußerte sich damals skeptisch gegenüber Lidarsensoren, die von Konkurrenten wie Waymo genutzt werden, und setzte stattdessen auf Kamera- und Radar-basierte Systeme. Comma.ai, ein jüngerer Wettbewerber, verfolgt eine ähnlich softwarezentrierte Strategie und gilt als stets knapp hinter Tesla positioniert. Beide Firmen konzentrieren sich darauf, autonome Systeme zu entwickeln, die auf möglichst vielen verschiedenen Straßen und Umgebungen funktionieren, um letztlich universelle Autonomie zu ermöglichen. Doch hier liegt genau das Problem: Die Ambition, ein System zu schaffen, das „überall“ funktioniert, übersieht die Tatsache, dass der überwiegende Teil des Verkehrs und der Mobilität in stark urbanisierten Gebieten stattfindet.
Eine der zentralen Erkenntnisse aus der Analyse von Philip Kopylov, einem unabhängigen Autonomie-Enthusiasten, ist die Tatsache, dass der Großteil der Bevölkerung in urbanen Zentren lebt. Nach aktuellen Statistiken leben mehr als 80 Prozent der US-Bevölkerung in Städten, und diese Zahl steigt weiter an. Weltweit wird erwartet, dass 68 Prozent der Menschen bis 2050 in urbanen Gebieten leben. Diese Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen auf den Verkehrsmarkt und somit auf die Strategie von Unternehmen, die autonome Fahrzeuge voranbringen wollen.Waymo, die Tochterfirma von Google, hat den Wert dieser urbanen Zentren als strategischen Fokus erkannt und setzt auf stark geofencete, dichte Stadtgebiete, in denen die Komplexität des Verkehrs für autonome Systeme herausfordernd, aber kontrollierbar ist.
Im Gegensatz zu Tesla und Comma.ai, die einen nahezu universellen Ansatz verfolgen, konzentriert sich Waymo auf diese sogenannten „Last Mile“-Anwendungen in Städten. Dies hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen: Waymo konnte seine Anzahl an bezahlten, fahrerlosen Fahrten innerhalb weniger Monate exponentiell steigern, von wenigen Tausend auf über eine Viertelmillion pro Monat. Der Fokus auf urbane Umgebungen erlaubt es Waymo, die Herausforderungen des städtischen Verkehrs — etwa komplexe Kreuzungen, Fußgänger, Radfahrer und Verkehrszeichen — nicht zu umgehen, sondern gezielt zu meistern.Ein weiterer großer Vorteil des Fokus auf Städte ist die erhöhte Sicherheit.
Stadtfahrten finden meist bei gemäßigten Geschwindigkeiten von 30 bis 40 mph statt, was die Risiken und Folgen von Unfällen im Vergleich zu schnellen Autobahnfahrten drastisch reduziert. Tesla hingegen bewirbt sein System häufig mit der Fähigkeit, auf Autobahnen mit 60+ mph autonom zu fahren, was zwar ambitioniert ist, aber auch signifikant höhere Risiken birgt. Bei Tesla gab es in der Vergangenheit mehrere tödliche Unfälle, die teilweise auf Fehler im Autopiloten zurückgeführt wurden. Waymo dagegen konnte bislang keine nennenswerten Unfälle mit seinen fahrerlosen Fahrzeugen in Städten verzeichnen, was durch ihre enge Geofencing-Strategie unterstützt wird.Der vermeintliche Nachteil des Geofence, der Waymo in der Vergangenheit oft als Schwäche ausgelegt wurde, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als strategischer Vorteil.
Viele Kritiker argumentierten, dass die Städte als Startpunkt für autonomes Fahren zu eingeschränkt sind und der wahre Durchbruch erst mit dem Fahren „irgendwo“ außerhalb von gesicherten Zonen möglich ist. Doch das Ignorieren des Faktors „Lebensrealität“ hat zu einer Fehleinschätzung der Marktdynamik geführt. In der Realität spielen sich die meisten Fahrten dort ab, wo Menschen leben — also in Städten und Vororten. Tesla und Comma.ai versuchen, die komplexe Herausforderung der Stadtfahrten zu umgehen, indem sie sich auf Autobahnen und weniger regulierte Umgebungen konzentrieren, was sich langfristig als ineffizient herausstellen könnte.
Ein weiterer Punkt, den Kopylov anspricht, ist der Unterschied im Geschäftsmodell. Waymo agiert als Taxiunternehmen und operiert somit eine Flotte, die konstant im Einsatz ist. Das bedeutet, die hohen Anschaffungskosten für LIDAR-Sensoren und weitere Technologie amortisieren sich schneller, da die Fahrzeuge fast rund um die Uhr eingesetzt werden. Ein privates Fahrzeug hingegen steht oft die meiste Zeit still, was diese Investition wirtschaftlich schwieriger macht. Auch wenn Tesla sich als Hersteller von Privatfahrzeugen positioniert, ist das Ziel, eine autonome Taxi-Flotte aufzubauen, um letztlich das Mobilitätsmodell zu revolutionieren.
Bislang wirkt der Start des Tesla-Robotaxis mit nur einem Dutzend Fahrzeugen in Austin eher wie ein Experiment denn eine ernsthafte Skalierung. Im Vergleich zu Waymos riesiger Flotte in kalifornischen Städten zeigt sich klar, dass Geschwindigkeit und Reichweite in der etablierten Stadtmobilität entscheidend sind.Auch die Kostenentwicklung bei LIDARs hat Einfluss auf die Marktdynamik. Während Elon Musk LIDARs als „dumm“ abtat, sind diese Sensoren mittlerweile deutlich günstiger geworden und bieten eine zuverlässige Sicherheits- und Funktionsbasis für autonomes Fahren, gerade in den komplexen urbanen Umgebungen, wo präzise Entfernungs- und Objekterkennung essenziell ist. Die Kombination aus sinkenden Hardwarekosten und der effizienten Nutzung im Taxi-Geschäftsmodell unterstützt damit Waymos Ansatz.
Neben technischen und wirtschaftlichen Aspekten spielen gesellschaftliche und infrastrukturelle Faktoren eine Rolle. Städte sind darauf angewiesen, dass Mobilität effizient und sicher gestaltet wird. Autonome Fahrzeuge in urbanen Gebieten können zu einer Reduktion von Staus, verbesserter Luftqualität und höherer Verkehrssicherheit beitragen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Gleichzeitig fordert dies eine kontinuierliche Anpassung und Integration in bestehende Verkehrssysteme. Städte sollten bei der Entwicklung autonomer Technologien eine aktive Rolle einnehmen, um Verkehrsflüsse zu optimieren und die Mobilitätswende zu gestalten.
Tesla und Comma.ai konzentrieren sich stark auf die technologische Herausforderung des universellen autonomen Fahrens, jedoch vernachlässigen sie damit die Marktrealitäten und echten Bedürfnisse einer urbanen Gesellschaft. Ein realistischeres und nachhaltigeres Geschäftsmodell basiert stattdessen auf der schrittweisen Umsetzung in kontrollierten, urbanen Bereichen, wo die Komplexität zwar hoch, aber lösbar ist und die Nutzerakzeptanz groß sein kann. Waymo hat diesen Trend erkannt und nutzt die Möglichkeit, autonomes Fahren zunächst in dicht bevölkerten, jedoch begrenzten Gebieten zu perfektionieren und so das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Städte aufzubauen.Zusammenfassend ist der entscheidende Faktor, den Tesla und Comma.
ai übersehen haben, das Prinzip des 80/20: Rund 80 Prozent des Verkehrs spielen sich in 20 Prozent der möglichen Umgebungen ab — nämlich den urbanen Zentren. Den Fokus darauf zu legen, bedeutet, die meisten Nutzer direkt zu erreichen und gleichzeitig in einem Umfeld zu operieren, das gut genug kontrolliert werden kann, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Die größte Herausforderung liegt darin, die letzten 20 Prozent der Umgebungen abzudecken, aber diese erfordern unverhältnismäßig viel Aufwand und Risiko. In einer Zeit, in der Städte weltweit wachsen und die Mobilitätsbedürfnisse steigen, ist es sinnvoller, mit einem fokussierten, urbanen Ansatz zu starten als die schier unendlichen Herausforderungen ländlicher und hochdynamischer Autobahnfahrten als Erstes zu lösen.Die Zukunft gehört wahrscheinlich denjenigen Unternehmen, die es schaffen, flächendeckend urbane autonome Mobilität zuverlässig zu implementieren und dann ihre Systeme sukzessive auf weitere Verkehrssituationen auszudehnen.
Dabei spielen nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nutzersicherheit, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und die Akzeptanz durch Gesellschaft und Politik eine zentrale Rolle. Tesla und Comma.ai haben wichtige Beiträge geleistet, doch der Siegeszug der Robotaxis wird vermutlich eher eine Geschichte von spezialisierten, strategisch agierenden Flotten sein, die sich an der Realität des urbanen Verkehrs orientieren und so Schritt für Schritt den Weg zu einer umfassenden Fahrzeugautonomie ebnen.




![The Natural Rate of Interest is Zero (2005) [pdf]](/images/7AC88C50-BF25-4FC2-BD69-1ACFDBF5B94B)