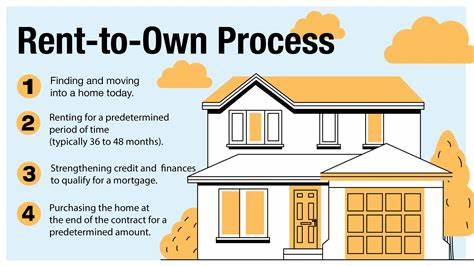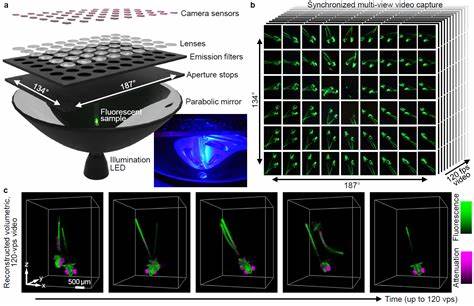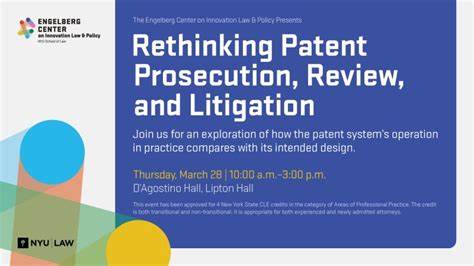Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten sind stark von der politischen Richtung und insbesondere von der Zollpolitik der Regierung geprägt. In den letzten Jahren hat die Trump-Administration eine Reihe von Zolltarifen auf ausländische Waren eingeführt, die vor allem das Ziel verfolgen, die einheimische Produktion zu stärken und Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Doch wie reagieren institutionelle Investoren auf diese von außen diktierten Veränderungen, und inwieweit beeinflussen diese ihre Kurz- und langfristigen Erwartungen? Eine umfassende Studie des US-Ablegers der großen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG wirft Licht auf die aktuelle Stimmung unter 300 US-Investoren und zeigt ein differenziertes Bild, das von kurzfristiger Skepsis und langfristiger Zuversicht geprägt ist. In den ersten Monaten des Jahres, also bevor die Tarifforderungen voll wirksam wurden, äußerten sich investitionsstrategisch tätige Personen mit überwiegend positiver Erwartungshaltung bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung der kommenden 18 Monate. Rund 96 Prozent der Befragten zeigten sich ausnahmslos optimistisch oder zumindest eher zuversichtlich, was die kurzfristigen Wachstumsaussichten betrifft.
Doch im April, kurz nach der Umsetzung neuer Zollmaßnahmen, fiel dieser Wert signifikant auf 84 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang um 12 Prozentpunkte, der deutlich auf die Unsicherheiten durch die Tarifpolitik zurückzuführen ist. Die Beobachtung von KPMG bestätigt, dass die bestehende Zollpolitik die Kapitalflüsse und Investitionsentscheidungen der institutionellen Investoren spürbar beeinflusst. Denn Tarife erhöhen in der Regel die Kosten für importierte Rohstoffe und Fertigprodukte, was unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen haben kann, die stark in die globalen Lieferketten eingebunden sind. Dies führt zu einer vorsichtigeren Haltung, insbesondere bei Investments, die von externen Schwankungen stärker betroffen sind.
Jene Anleger suchen zunehmend Sicherheit und bevorzugen daher Unternehmen, die sich weniger Risiken durch Handelskonflikte aussetzen. Interessanterweise zeigt sich ein anderer Trend in der längerfristigen Perspektive der Investoren. Während die kurzfristige Zuversicht sinkt, stieg die positive Erwartung für Zeiträume von über 18 Monaten zwischen den beiden Befragungszeitpunkten von 84 auf 92 Prozent. Dies signalisiert eine wohl überlegte Einschätzung, dass selbst wenn die aktuellen Spannungen und Unsicherheiten zutreffen, der amerikanische Markt und seine Unternehmen letztlich von einer protektionistischen Politik zumindest mittel- bis langfristig profitieren könnten. Das Ziel der Zollpolitik wird von der Administration darin gesehen, die Fertigungskapazitäten und Arbeitsplätze innerhalb der USA zu stärken und so von einer Abhängigkeit von Importen zu entkoppeln.
Dieses Ziel wird von vielen Investoren als grundsätzlich positiv bewertet, auch wenn der Weg dorthin kurzfristig mit Unsicherheiten und Kostensteigerungen verbunden ist. KPMG-Partner Tarek Ebeid weist darauf hin, dass diese Maßnahmen „institutionelle Investoren dazu zwingen, ihre Anlagestrategien und Risikobereitschaft neu zu beurteilen“. Ein klarer Fokus auf amerikanische Unternehmen und Branchen, die weniger verwundbar gegenüber externen Marktbedingungen sind, entsteht dadurch als Folge der aktuellen Handelskonflikte. Die zeitliche Dimension der Unsicherheit ist allerdings differenziert wahrgenommen: Etwa 40 Prozent der befragten Experten erwarten, dass die wirtschaftlichen Turbulenzen durch die Zollvorgaben sich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wieder legen. Rund ein Viertel rechnet jedoch mit einer deutlich längeren Phase der Ungewissheit, die bis zu mehr als zwei Jahren andauern könnte.
Diese Bandbreite unterstreicht die Vielfalt der Meinungen im Markt und die Schwierigkeit, präzise Prognosen in einem so dynamischen Umfeld zu treffen. Darüber hinaus hegen knapp die Hälfte der Investoren die Befürchtung, dass die US-Wirtschaft innerhalb der nächsten 18 Monate in eine Rezession abgleiten könnte. Diese vorsichtige Haltung ist nicht unbegründet, denn Handelskonflikte und steigende Produktionskosten haben das Potenzial, Konsum und Investitionen zu bremsen. Die finanziellen Führungskräfte, deren Meinungen in einer separaten Umfrage abgebildet wurden, berichten, dass ein Fünftel bereits davon ausgeht, dass sich die US-Wirtschaft bereits in einer Rezession befindet. Dies zeigt, in welchem Spannungsfeld sich Entscheidungsträger aktuell bewegen.
Neben den unmittelbaren Folgen für Investitionsentscheidungen wirken sich die Zölle zudem auf die Märkte aus. Die Volatilität an den US-Börsen nimmt zu, und es wird klar, dass Investoren verstärkt auf geopolitische und handelspolitische Ereignisse achten, um ihre Risiken abzusichern. Technologiewerte, Industrieunternehmen und solche, die von internationalen Lieferketten stark abhängen, sind besonders betroffen von dieser erhöhten Vorsicht. Gleichzeitig zeigt sich eine verstärkte Aufmerksamkeit auf Branchen, die vom Binnenmarkt profitieren oder technologiegetriebene Wettbewerbsvorteile in den USA halten. Die Verlagerung des Fokus auf heimische Unternehmen und die damit verbundene Veränderung im Anlageverhalten könnte mittelfristig signifikante Auswirkungen auf den amerikanischen Wirtschaftskreislauf und die Struktur des Kapitalmarktes haben.
Unternehmen, die flexibel sind und ihre Produktionsstandorte in die USA zurückverlagern oder ihre Lieferketten entsprechend anpassen können, profitieren von dieser neuen Investitionsdynamik. Hieraus ergeben sich Chancen, aber auch Herausforderungen für Unternehmensleitungen, die zeitnah strategisch reagieren müssen. Demgegenüber bleibt die globale Vernetzung der Wirtschaft ein Faktor der Komplexität. Zollpolitische Maßnahmen in den USA verursachen oftmals Gegenreaktionen anderer Handelsmächte und können internationale Handelsbeziehungen belasten. Diese Dynamik stellt Investoren weltweit vor die Notwendigkeit, Risiken breit zu streuen und flexible Strategien zu entwickeln, um auf sich schnell ändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können.