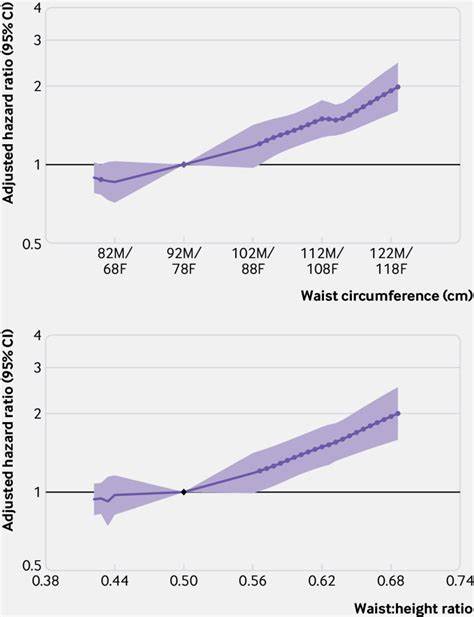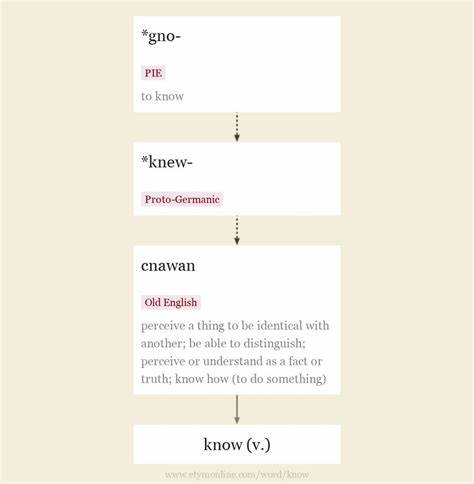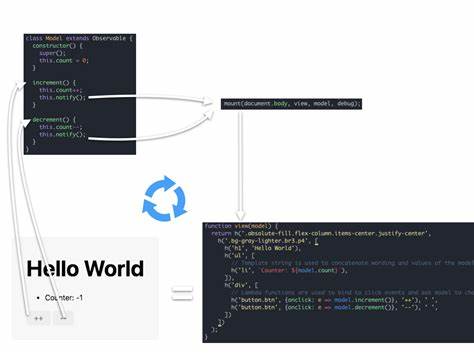Am Morgen eines scheinbar gewöhnlichen Samstags erschütterte eine Explosion die amerikanische Reproduktionsklinik American Reproductive Centers, als ein geparkter SUV detonierte. Bei der Tat starb der Fahrer, und mehrere Unbeteiligte wurden verletzt. Schnell stuften Bundesbehörden das Ereignis als Terroranschlag gegen die Praxis der In-vitro-Fertilisation ein. Kurz darauf tauchte eine minimalistische Website namens promortalism.com auf, auf der der Täter, der 25-jährige Guy Edward Bartkus, das „Krankheitserlebnis Leben“ verdammte und dazu aufrief, sein veröffentlichtes Stream-Suizid- und Bombenmanifest nachzuahmen und zu verbreiten – ehe die Seite rasch zensiert wurde.
Doch welche Ideologie steckte hinter dieser Tat? Und war ein solches Ereignis tatsächlich vorprogrammiert? Um zu verstehen, warum Efilismus mehr ist als nur eine abstrakte Idee, muss man sich mit seinen Wurzeln, der Philosophie dahinter und dem sozialpsychologischen Kontext auseinandersetzen. Efilismus ist ein radikaler Zweig des Antinatalismus, der dem Leben nicht nur skeptisch gegenübersteht, sondern es als inhärentes Übel betrachtet. Der Begriff selbst, eine Umkehrung des Wortes „Leben“ (englisch: life), impliziert eine radikal pessimistische Sichtweise auf die Existenz. Diese Bewegung stellt die Behauptung auf, dass das gesamte Dasein – vor allem weil es Leiden erzeugt – aufgehoben werden sollte, um künftiges Leid auszuschließen. David Benatar, ein südafrikanischer Philosoph, legte mit seinem 2006 veröffentlichten Buch „Better Never to Have Been“ wesentliche Grundgedanken dazu vor.
Er argumentierte, dass die Abwesenheit von Schmerz stets positiv sei, während das Fehlen von Freude nur für denjenigen von Bedeutung ist, der sie zu vermissen hat. Daraus folgerte er, dass keine neue Geburt moralisch gerechtfertigt ist, da sie zwangsläufig neues Leid in die Welt bringt. Diese antinatalistische Philosophie fand den Weg in Online-Debatten und Foren, vor allem auf Plattformen wie YouTube, wo Nutzer begannen, philosophische und ethische Diskussionen darüber zu führen. Doch Efilismus ging noch einen entscheidenden Schritt weiter. Der Vlogger und Amateurphysiker Gary Mosher, bekannt als „Inmendham“, prägte den Begriff und postulierte, dass nicht nur das Individuum, sondern die gesamte Spezies ausgelöscht werden sollte, da jede Existenzform ein „Fabrikator des Leidens“ sei.
Mosher zeigte sich dabei zynisch und kompromisslos: In seinem Weltbild wäre auch eine schnelle, radikale Auslöschung der Menschheit gerechtfertigt, um das „Großes Böse“ des Lebens zu beenden. Seine Ideen fanden nicht nur Anhänger, sondern auch Nachahmer, die die abstrakte Philosophie in die Praxis umzusetzen versuchten. Der Bombenanschlag von Bartkus zeigt daher, dass diese Gedankenwelt durchaus eine gefährliche Radikalisierung erfahren kann – wenngleich er offenbar nicht ausschließlich durch seine Überzeugung zum Gewalttäter wurde. Vielmehr spielte der Suizid seiner engen Freundin, die sich auf dramatische Weise das Leben nahm, eine entscheidende Rolle bei seiner emotionalen Verfassung und seiner finalen Handlung. Seine Taten wurden von einer Mischung aus psychischem Schmerz, Vereinsamung und der Suche nach Bedeutung in einer Welt ohne Hoffnung getrieben.
Dabei lässt sich erkennen, wie fragile Seelen im Kontext solch radikaler Ideologien oft den Halt verlieren. Es zeigt sich auch, dass der soziale Zusammenhalt und zwischenmenschliche Beziehungen entgegen der Haltung der Efilisten eigentlich zentrale Bestandteile menschlicher Existenz bleiben. Trotz aller Nihilismus und Verachtung gegenüber dem Leben bedeutete der Verlust seiner Freundin für Bartkus eine emotionale Erschütterung, die ihn letztlich vorantrieb. Die Verquickung von radikaler Philosophie mit der Realität psychischer Erkrankungen, wie Borderline-Persönlichkeitsstörung, misandrischer Ansichten und antisexistischer Haltungen, die im Fall Bartkus ebenfalls eine Rolle spielten, macht eine einfache Erklärung unmöglich. Auch die Schnittstellen zum sogenannten „Promortalismus“ oder zu Bewegungen wie den Zizianern, welche Gewalt als legitimes Mittel ansehen, um zukünftiges Leid zu verhindern, verdeutlichen, dass es in diesen Szenen eine Dynamik von Ideologisierung und Radikalisierung gibt.
Die Rolle von Influencern und öffentlichen Figuren in der Szene kann ebenfalls nicht unterschätzt werden. Gary Mosher und andere, wie Amanda Sukenick, prägen die narrative Ausrichtung der Bewegung; zugleich distanzieren sie sich öffentlich von Gewalt – wenngleich ihre teils kontroversen Äußerungen und die Verherrlichung eines „radikalen Nihilismus“ eine problematische Ideologiebildung befördern. Kritik wächst vor allem innerhalb der antinatalistischen Gemeinschaft, die eine deutlich gewaltfreie Ethik propagiert und sich unwohl fühlt mit den aggressiven Rhetoriken und dem Versuch, Antinatalismus durch den extremistischen Efilismus zu „efilizieren“. Die Geschichte des Anschlags zeigt außerdem eindrücklich die Herausforderungen für Präventionsarbeit und gesellschaftliche Reaktion auf solche Phänomene. Direkte politische Forderungen oder sichtbare Organisationen gibt es dabei kaum, die Gefahren liegen vielmehr in verstreuten Internetforen, Online-Videos und sich radikalisierenden Einzelpersonen.
Das macht eine klassische Beobachtung und Intervention besonders schwierig. Zugleich erinnert der Fall an die Bedeutung von psychischer Gesundheit und menschlicher Nähe als präventive Faktoren gegen derartige Taten. Trotz aller digitalen Vernetzung führen emotionale Isolation und ideologische Schwarz-Weiß-Schemata zu gefährlichen „Gedankenschleifen“, die in Endlosschleifen eskalieren können. Bei der Berichterstattung und Analyse solcher Extremfälle ist es wichtig, zwischen der Überzeugung und der Ursache der Tat zu differenzieren. Bartkus’ Handeln entsprang keineswegs einem kalkulierten Plan, die Welt ideologisch „sauberer“ zu machen.
Vielmehr spiegelte sich sein persönliches Leid in einer verfehlten, radikalen Moralpolitik wider. Sein tragisches Ende zeigt, dass die Bereitschaft zur Gewalt in Fällen wie diesem immer auch den Ausdruck eines inneren Notstands darstellt. Für die Gesellschaft gilt es daraus wichtige Lehren zu ziehen. Die beste Prävention gegen solche Anschläge kann nur durch die Stärkung sozialer Bindungen, frühzeitige psychologische Hilfsangebote und eine kritische, aber verständnisvolle Auseinandersetzung mit radikalen Weltbildern erreicht werden. Im Kontext zunehmender digitaler Radikalisierung und fragmentierter politischer Landschaften werden Diskussionen über Efilismus, Antinatalismus und verwandte Ideologien auch weiterhin notwendig bleiben.
Sich mit diesen philosophischen Ansätzen auseinanderzusetzen, bereitet uns nicht nur auf kommende gesellschaftliche Herausforderungen vor, sondern ermöglicht auch einen bewussteren Umgang mit existenziellen Fragen über Leben, Leiden und ethische Verantwortung. Die Tragik des Anschlags vor einer Fruchtbarkeitsklinik ist dabei ein warnendes Signal, wie gefährlich ideologisch verbrämter Nihilismus in Kombination mit psychischem Ausnahmezustand sein kann. Nicht das abstrakte Konzept selbst, sondern deren Radikalisierung und die damit einhergehenden sozialen Dynamiken machen Vorfälle wie diesen möglich. Die Debatte wird die Gesellschaft weiter begleiten müssen, um den feinen Grenzverlauf zwischen philosophischer Reflexion und gefährlicher Extremaxion zu erkennen und zu bearbeiten.