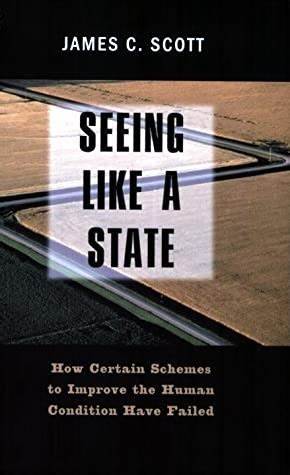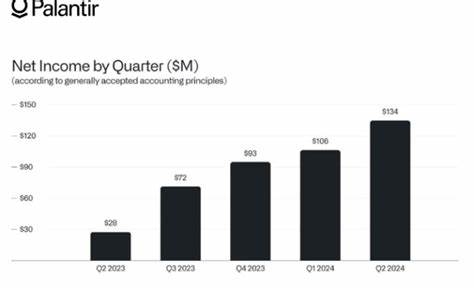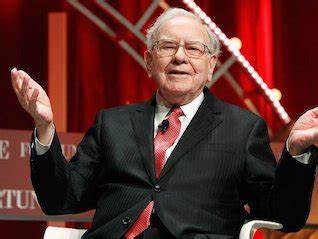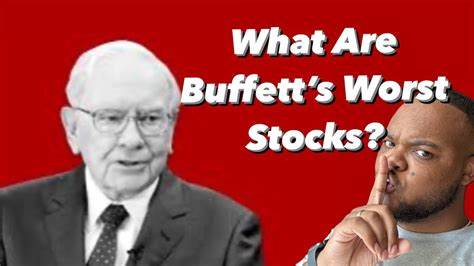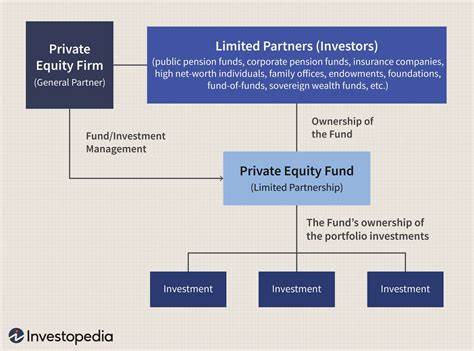Das Konzept „Seeing Like a State“ von James C. Scott hat seit seiner Veröffentlichung 1998 eine bemerkenswerte Resonanz gefunden. Es erklärt die tiefgreifenden Probleme, die entstehen, wenn komplexe soziale Systeme durch zentralisierte, oft autoritäre Verwaltungsmechanismen vereinfacht und geplant werden. Von der Forstwirtschaft in Preußen über die sowjetische Kollektivierung bis hin zur Stadtplanung entstanden viele Vorhaben, die scheinbar rational gestaltet waren, aber mit katastrophalen Folgen endeten. Was aber hat dieses Konzept mit heutigen staatlichen Universitäten zu tun? In einer Zeit, in der öffentliche Hochschulen zunehmend unter dem Druck von Effizienz, Messbarkeit und politischen Vorgaben stehen, offenbart Scotts Kritik genau die Gefahren, die entstehen, wenn Bildung als standardisierbares Produkt begriffen wird.
Im Kern beschreibt der Begriff „high modernism“ eine Haltung, die Vertrauen in rein rationale Planung und staatliche Macht vereint. Diese Haltung geht davon aus, dass sich menschliche und soziale Realitäten durch wissenschaftliche Prinzipien und Verordnungen verbessern lassen. Im Fall von Hochschulen manifestiert sich diese Denkweise in der Forderung nach klar messbaren „Produkten“ wie Absolventenzahlen, bestimmten Studiengängen oder festgelegten Berufsperspektiven. Solch eine Vereinfachung übersieht jedoch die organische Komplexität von Bildung, die vielfältigen Interessen der Studierenden und die Bedeutung von kulturellem, sozialem und individuellem Wissen. Die heutige öffentliche Hochschullandschaft in Deutschland und anderen Ländern trägt viele Symptome dieser high modernistischen Diagnose.
Staatliche Hochschulsysteme sind stark hierarchisch, mit strengen Vorgaben für Studieninhalte, Zugang, Finanzierung und Evaluation. Daraus resultieren immer wieder Kritikpunkte wie hohe Kosten, die Unübersichtlichkeit des Systems, mangelnde praktische Orientierung, einseitige politische Kultur und der Verdacht von Elitarismus. Dabei sind diese Herausforderungen keine Zufälle, sondern folgen logisch aus einer zentralplanerischen Denkweise, die Prozesse auf wenige messbare Größen reduziert und Flexibilität zugunsten von Kontrolle opfert. Ein exemplarisch passendes Beispiel ist die Bewertung von Hochschulabschlüssen allein über Kennzahlen wie Einstiegsgehälter oder Berufszufriedenheit. Statt die kulturelle und intellektuelle Breite einer liberalen Bildung zu würdigen, wird Bildung häufig als bloßer Dienstleister für den Arbeitsmarkt verstanden.
Dies führt dazu, dass Studiengänge der Geisteswissenschaften systematisch benachteiligt werden, da sie vermeintlich keine direkten und gut bezahlten Berufsperspektiven bieten. Dabei zeigt die Realität, dass der Wert einer Ausbildung häufig jenseits solcher direkten Verwertbarkeitsmaßstäbe liegt, beispielsweise in der Förderung kritischen Denkens, kultureller Kompetenz und gesellschaftlicher Teilhabe. Ein weiterer Aspekt des Problems ist das starre Raster, in dem Bildungseinrichtungen und Arbeitsmarkt miteinander verknüpft werden. Wie in Scotts Theorie beschrieben, bildet der Staat bevorzugt simple Karten, die Menschen in klar definierte Kategorien und Klassifikationen zwängen. Im Hochschulbereich sind das etwa die sogenannten Classification of Instructional Programs (CIP) und Standard Occupational Classification (SOC) Codes, die Studiengänge bestimmten Berufen zuweisen.
Diese Zuordnung ist jedoch oft wenig repräsentativ für die tatsächlichen Wege von Absolventen. Wenn ein Geisteswissenschaftler beispielsweise eine Ausbildung zum Handwerker oder Techniker macht – eine Alternative, die gerade angesichts der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung an Bedeutung gewinnen könnte – wird er im System als „Fehlplatzierung“ gewertet, da diese Verknüpfung im Raster nicht vorgesehen ist. Die Folgen solcher Vereinfachungen sind weitreichend und real. Hochschulen erhalten auf Basis dieser Daten finanzielle Mittel, Bewertungen und Rankings. Studiengänge, deren Absolventen nicht den vorgegebenen Erwartungen entsprechen, gelten als „schlecht“ oder „ineffizient“.
Dies verstärkt einen Teufelskreis, in dem Innovation, Diversität und individuelle Wege unterdrückt werden, um statistische Werte zu optimieren. Die menschliche Komplexität und der kulturelle Reichtum werden somit der Simplifizierung geopfert, was letztlich das Vertrauen in die Hochschulen und deren Fähigkeit, zukünftige Herausforderungen zu meistern, untergräbt. Interessanterweise könnten gerade durch die fortschreitende Digitalisierung und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz neue Perspektiven entstehen. Einige traditionelle Berufe, etwa im Handwerk, könnten sich als widerstandsfähiger gegen Automatisierung erweisen als viele klassische Bürojobs, für die Geisteswissenschaftler oft vorbereitet werden. Dennoch bleibt die Hochschullandschaft in der Regel starr an alten Verknüpfungen und Bewertungsmaßstäben hängen und tut sich schwer, solche Veränderungen zu integrieren.
Dies verdeutlicht den Verlust an Flexibilität, den Scotts High Modernism kritisiert hat: ein rigoroses Festhalten an alten Modellen und Raster, die der dynamischen Realität nicht gerecht werden. Aus Sicht der Studierenden und der gesellschaftlichen Entwicklung wirft das drängende Fragen auf. Sollte Bildung lediglich als Karrierevorbereitung verstanden werden, oder hat sie einen weitreichenderen Auftrag? Für eine funktionierende Demokratie ist es essenziell, dass Bürgerinnen und Bürger komplexe Zusammenhänge verstehen, unterschiedliche Perspektiven einnehmen können und kulturelle Werte teilen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften tragen genau dazu bei, sie bieten „kulturelles Kapital“, eine Grundlage für zivilgesellschaftliches Engagement und kritisches Denken. Diese Qualitäten sind nicht direkt messbar, werden im aktuellen System jedoch kaum noch honoriert.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie Hochschulen individueller auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen können. Das starre System drängt beispielsweise diejenigen mit ungewöhnlichen Karriereplänen – etwa eine Studentin mit einem geisteswissenschaftlichen Abschluss, die eine berufliche Zukunft im Handwerk anstrebt – oft in die „Scheifelecke“. Sie gilt statistisch als Misserfolg und erfährt selten Unterstützung oder Anerkennung. Dadurch gehen talentierte und motivierte Menschen verloren, da institutionelle Strukturen ihre Möglichkeiten einschränken und sie letztlich davon abhalten, ihren eigenen Weg zu finden. Ein Lösungsansatz könnte darin bestehen, die strikte Verbindung zwischen Studienprogramm und Berufspfad zu entflechten.
Neue Daten- und Analysemethoden sollten individuelle Kompetenzen und Fähigkeiten in den Vordergrund stellen, anstatt auf generelle Programm-Labels zu setzen. Ein stärkerer Bezug auf Tätigkeiten und Fähigkeiten etwa durch das O*NET-System, das konkrete Anforderungen von Berufen erfasst, wäre hier hilfreich. So könnten unorthodoxe Karrierewege sichtbar werden und Hochschulen angemessen für vielfältige Absolventenerfolge honoriert werden. Auch die Integration von praxisnahen Ausbildungen, wie etwa dualen Studiengängen oder direkt anschließenden Handwerkslehren, sollte gefördert werden. Ein solches „Rewilding“ der Hochschullandschaft, bei dem starre Strukturen aufgebrochen und vielfältige Bildungspfade zugelassen werden, könnte der aktuellen Krise des öffentlichen Hochschulwesens entgegenwirken.
Gleichzeitig eröffnet es Möglichkeiten, den Arbeitsmarkt besser mit dem Bildungssystem zu verzahnen und die Studierenden auf eine sich rapide verändernde Berufswelt vorzubereiten. Trotz aller Probleme darf dabei nicht übersehen werden, dass Hochschulen bereits heute viel Raum für Pluralismus, freie Forschung und vielfältige Studiengänge bieten. Die zentralistischen Tendenzen und Instrumente bilden jedoch einen Gegenpol, der den kreativen und menschlichen Aspekten einer Bildung wesentliche Ressourcen und Anerkennung entzieht. Um den gesellschaftlichen Wert der Hochschulbildung dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln, muss diese Spannung gelöst werden. Nicht zuletzt wirft Scotts Analyse auch ein kritisches Licht auf die politische und ideologische Steuerung öffentlicher Hochschulen.
Die Erwartung von Gleichschaltung etwa durch verpflichtende Diversity-Schulungen, ideologische Vorgaben oder das Streben nach uniformen Zielvorstellungen erinnert an Modelle, die Scott als neo-leninistisch beschreibt. Dabei stehen diese Programme oft im Widerspruch zur traditionellen Idee eines offenen Diskurses, der unterschiedliche Meinungen und kritisches Hinterfragen zulässt. Die Balance zwischen gesellschaftlicher Verantwortung, politischer Steuerung und akademischer Freiheit stellt damit eine weitere große Herausforderung dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hochschulbildung heute mehr denn je vor der Gefahr steht, in ein zu starres und eindimensionales Raster gepresst zu werden. Die Vereinfachung komplexer menschlicher Bildung auf messbare Größen und standardisierte Ausbildungswege unterschätzt die Vielfalt individueller Lebensentwürfe, die Bedeutung kultureller Bildung und die Dynamik einer sich wandelnden Arbeitswelt.
Die Herausforderung besteht darin, den Wert von Hochschulbildung umfassender zu erfassen, die Komplexität menschlicher Entwicklungswege abzubilden und institutionelle Strukturen flexibilisieren, ohne dabei an Qualität oder Zugänglichkeit einzubüßen. James C. Scotts Werk und seine Übertragung auf den Hochschulsektor eignen sich hervorragend als Rahmen, um diese tiefgreifenden Probleme zu verstehen und neue Ansätze für eine zeitgemäße, vielfältige und demokratisch verfasste Hochschullandschaft zu entwickeln. Eine „state university“ im Sinne eines bloßen Instrumentes einer politischen Verwaltung reicht nicht aus, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Vielmehr braucht es ein Hochschulsystem, das die Komplexität menschlichen Lernens anerkennt und sich gegen die Vereinfachungen und Zwänge der Zentralplanung wehrt – mit Offenheit, Innovation und einem starken Bekenntnis zur kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt.
Nur so kann der Wert von Bildung für Individuum und Gesellschaft neu entfaltet werden.