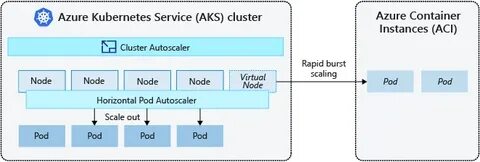Isaac Asimov, der berühmte Science-Fiction-Autor und Wissenschaftspublizist, veröffentlichte im Jahr 1964 einen visionären Text, in dem er seine Gedanken über die Zukunft der Menschheit und technische Entwicklungen aus der Perspektive des Jahres 2014 schilderte. Der essayistische Aufsatz „Visit to the World's Fair of 2014“ bietet neben futuristischen Prognosen auch eine tiefere philosophische Reflexion über die Auswirkungen von Fortschritt und Automatisierung auf die Gesellschaft, insbesondere das Phänomen der „Krankheit der Langeweile“. Asimov beginnt mit einer optimistischen Sicht auf den technologischen Fortschritt, der zum damaligen Zeitpunkt auf der New Yorker Weltausstellung 1964 präsentiert wurde. Die ausgestellten Szenen, die die Entwicklung elektrischer Geräte von 1900 bis 1960 zeigen, stecken den Rahmen für seine Zukunftsvision ab. Er stellt sich vor, wie das Leben im Jahr 2014 aussehen könnte, geprägt von technischen Errungenschaften, die das menschliche Leben komfortabler und effizienter machen würden.
Ein zentrales Element in Asimovs Prognose bildet das zunehmend vom Menschen kontrollierte und künstlich geschaffene Lebensumfeld. So wird postuliert, dass sich die Menschen immer mehr von der freien Natur entfernen, um ihre Umgebung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Elektrolumineszierende Paneele an Decken und Wänden, die sanfte Farbwechsel auf Knopfdruck ermöglichen, sowie Fenster mit automatisch einstellbarer Lichtdurchlässigkeit gehören zu den damaligen Zukunftsträumen. Besonders faszinierend sind die Visionen von unterirdischen Häusern und Städten, die vor Wetterunbilden schützen und dank automatisierter Licht- und Klimakontrolle ein konstant angenehmes Innenraumklima bieten. Auf technischer Ebene beschreibt Asimov auch den Fortschritt bei Haushaltsgeräten und Robotern.
So sieht er automechanisierte Küchen, die Mahlzeiten in vorbestimmter Zeit automatisch zubereiten. Obwohl die Vorstellung von Robotern im Jahr 2014 noch nicht in ihrer vollen Leistungsfähigkeit angekommen sein wird, erwartet er durchaus funktionstüchtige, wenn auch klobige und langsame Helfer beim Putzen und ordnen. Besonders interessant ist die Prognose, dass die Energiespeicher von Geräten ohne Stromkabel funktionieren und mit langlebigen radioaktiven Batterien betrieben werden. Diese würden aus Nebenprodukten von Kernkraftwerken gewonnen und nachhaltig verwendet. In puncto Energieversorgung sieht Asimov eine Dominanz der Kernenergie mit einer gewissen Entwicklung von Fusionskraftwerken, an denen bereits experimentiert wird.
Solarenergie spielt vor allem in sonnenreichen und weniger bevölkerten Gegenden eine zunehmend wichtige Rolle. Seine Vorstellung von Weltraumsolarkraftwerken, die Energie ins All sammeln und zur Erde übertragen, offenbart Asimovs Weitblick und sein Verständnis für globale Energieprobleme. Die Mobilität der Zukunft, so Asimov, wird sich stark wandeln. Während im Jahr 1964 die Zukunft mit größeren Straßen und Fahrzeugen auf der Erdoberfläche gedacht wurde, sieht er für 2014 eine Abnahme der Bedeutung klassischer Autobahnen vor. Stattdessen sagt er gleitende Fahrzeuge voraus, die durch Druckluft einige Zentimeter über der Erdoberfläche schweben.
Dieses Konzept minimiert Reibung, Straßenbelastung und Stauprobleme gleichermaßen. Zudem prognostiziert er Fahrzeuge mit künstlicher Intelligenz, sogenannte „Roboterautos“, die selbständig und sicher vorankommen, ohne auf menschliche Reflexe angewiesen zu sein. Auch der Infrastruktur für den Nahverkehr wird eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Asimov prognostiziert die Nutzung von beweglichen Gehsteigen, die erhöht über Verkehrswegen verlaufen und Passagieren während der Fortbewegung Sitzmöglichkeiten bieten. Die Verkehrssteuerung selbst soll automatisiert ablaufen.
Lieferungen werden zentralisiert, der Transport von Gütern durch pneumatische Röhrensysteme erfolgt und die gleichzeitige Koordinierung spezieller Sendungen ist eine logistische Meisterleistung der Zukunft. Eine weitere bahnbrechende Vorstellung betrifft die Kommunikation. Für 2014 sieht Asimov Bild-Telefonie als Standard vor. Telefonate werden nicht nur akustisch, sondern auch visuell geführt, ähnlich der heutigen Videotelefonie. Diese Technologie erlaubt auch das gemeinsame Betrachten von Bildern, Dokumenten oder Büchern in Echtzeit.
Der Einsatz synchroner Satelliten soll vielfältige weltweite und sogar interplanetare Kommunikation ermöglichen, etwa mit Stationen auf dem Mond oder bald auch Marskolonien. Die Verzögerung durch die Entfernung zu Himmelskörpern, etwa 2,5 Sekunden zum Mond und mehrere Minuten zu Mars, wird als technisch unvermeidbar eingeschätzt. Im Bereich Unterhaltung erwartet Asimov technische Neuerungen wie 3D-Fernsehen in Form von transparenten, sich drehenden Würfeln, die Zuschauer von allen Seiten einsehen können. Dies steht exemplarisch für das Bestreben, immersive Erlebniswelten im privaten Bereich zu etablieren. Trotz dieser positiven Aussichten zeigt Asimov auch ernste und besorgniserregende Entwicklungen auf, die eng mit der rapide wachsenden Weltbevölkerung verbunden sind.
Bereits 1964 verzeichnete die USA eine Bevölkerung von über 191 Millionen Menschen, und die globale Gesamtbevölkerung wuchs rasant an. Seine Schätzung für 2014 liegt bei rund 6,5 Milliarden Menschen weltweit, mit zunehmender Verstädterung und enormen Ballungen großer Bevölkerungskonzentrationen. Allein der Raum zwischen Boston und Washington soll zu einer einzigen Megastadt mit über 40 Millionen Einwohnern anwachsen. Diese Verdichtung führt zu unweigerlichen Folgen: Eindringen in extreme Lebensräume wie Wüsten, Polarregionen und der Beginn von Lebensräumen unter Wasser auf dem Meeresboden. Asimov beschreibt futuristische Unterwasserstädte und luxuriöse Hotels unter der Meeresoberfläche, die neue Lebensräume für eine wachsende Bevölkerung schaffen sollen.
Die Landwirtschaft steht unter immensem Druck, um die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern. Hier sieht Asimov eine Zunahme mikrobieller Nahrungsquellen wie Algen und Hefen vor, die neuartige Lebensmittel erzeugen, etwa sog. „Mock-Turkey“ oder „Pseudosteak“. Die Akzeptanz solcher Nahrungsmittel bleibt jedoch eine Herausforderung, da psychologische Abwehrmechanismen bei den Menschen gegen synthetische Lebensmittel bestehen. Einer der kritischsten Punkte in seinem Aufsatz ist die Problematik der Geburtenkontrolle.
Asimov erkennt an, dass die Technologie durch Automatisierung und medikamentöse Fortschritte die Lebenserwartung weiter erhöht und die Sterberate sinkt. Dadurch wächst der Druck auf die Erde durch Bevölkerungszunahme stetig weiter. Seiner Meinung nach bleiben zwei Optionen, um eine Überbevölkerung zu verhindern: die Erhöhung der Sterberate oder die Reduktion der Geburtenrate. Er plädiert entschieden für letztere durch humane und rationale Maßnahmen. Zur Eindämmung der Bevölkerungswachstums sieht Asimov eine globale Aufklärungskampagne vor, die schon 2014 wirksam sein sollte.
Trotzdem bezweifelt er, dass dies ausreichend sein wird, um das Wachstum vollständig zu kontrollieren. Seine Metapher, dass die Erde in etwa 500 Jahren zu einer einzigen übervölkerten „Welt-Manhattan“ werden könnte, zeichnet ein düsteres Bild einer möglichen gesellschaftlichen und ökologischen Katastrophe. Parallel dazu weist Asimov auf die soziale und psychologische Dimension der zukünftigen Gesellschaft hin. Die Automatisierung und der technologische Fortschritt führen dazu, dass „gewöhnliche“ Jobs zunehmend von Maschinen übernommen werden und der Mensch hauptsächlich noch als Maschinenbetreuer tätig ist. Damit verbunden ist ein Prozess der Entleerung herkömmlicher Arbeit, der eine neue Krankheit hervorruft – die „Krankheit der Langeweile“.
Diese ist weniger eine bloße Unlust, sondern ein ernstzunehmendes psychisches Leiden, das sich in einer Gesellschaft mit viel Freizeit und wenig sinnstiftender Beschäftigung immer weiter ausbreitet. Asimov betont die enorme Bedeutung der Psychiatrie im 21. Jahrhundert als Folge dieser Entwicklung. Nur die wenigen Menschen, die in schöpferische oder kreative Arbeit eingebunden sind, verbleiben aus seiner Sicht in einer privilegierten Position. Sie bilden eine geistige Elite, die mehr als nur technische Bedienung leisten kann.
Sein letztendlicher Ausblick ist dabei durchaus paradox: In einer Gesellschaft, in der Freizeit gesetzlich erzwungen wird, könnte das Wort „Arbeit“ aufgewertet und zum Ausdruck höchster menschlicher Erfüllung wirklichster Sehnsucht werden. Die Arbeit, als Geburtsquelle von Kreativität, Sinn und Selbstverwirklichung, gewinnt in einer automatisierten Welt an Glanz und Wert – entgegen der jahrzehntelangen Tradition, Arbeit als Last zu betrachten. Isaac Asimovs Prognosen sind auch heute noch bemerkenswert aktuell und dienen als Mahnung, den technischen Fortschritt nicht nur als Fortschritt an sich zu betrachten, sondern immer auch seine gesellschaftlichen, psychologischen und ethischen Auswirkungen zu reflektieren. Die „Krankheit der Langeweile“ ist eine Herausforderung, die in einer Welt der zunehmenden Automatisierung den Menschen erneut zwingen wird, einen neuen Sinn und Stellenwert für sich zu definieren. Neue Formen der Kreativität, Bildung und psychischen Gesundheit werden bedeutender denn je.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Asimovs Text von 1964 nicht nur eine Sammlung technischer Zukunftsvorstellungen ist, sondern vor allem ein vielschichtiger Kommentar zu den möglichen Krisen und Chancen einer technisierten Gesellschaft. Seine Warnungen vor Überbevölkerung, sozialer Entfremdung und Sinnkrisen sind ein Appell, den Fortschritt nicht mechanisch zu feiern, sondern verantwortungsvoll zu gestalten. Die „Weltausstellung 2014“ aus seiner Sicht ist somit weit mehr als eine Demonstration technischer Wunderwerke – sie ist ein Spiegel für die Herausforderungen, denen sich die Menschheit stellen muss, wenn sie die guten Seiten der Technik nutzen will, ohne in eine seelenlose Welt der Langeweile abzurutschen.
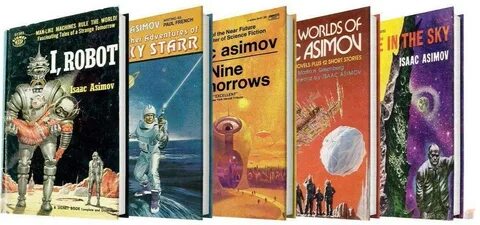



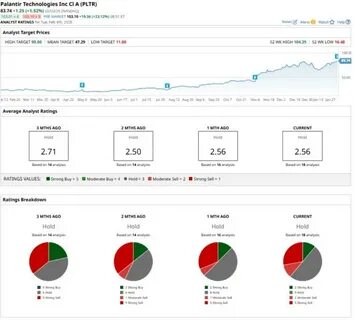
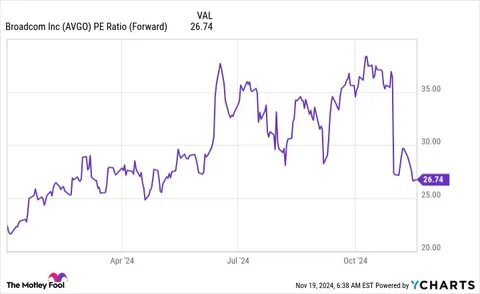


![Inspiration is perishable use it now [video]](/images/3081D8E4-5C85-4FAE-B64B-7CBF5EC44FE6)