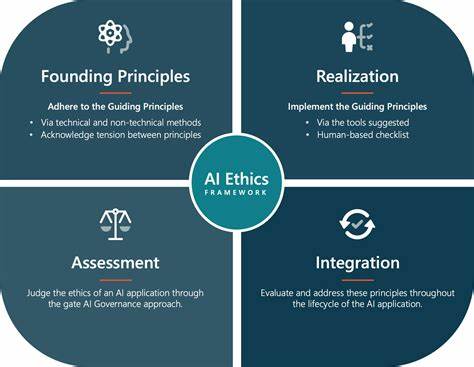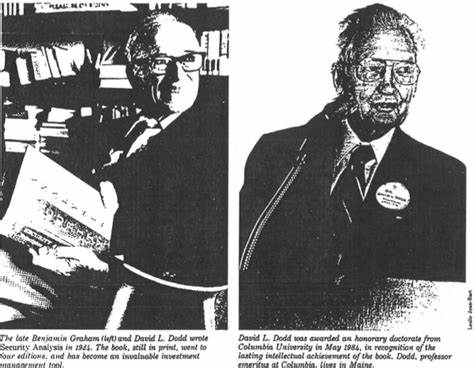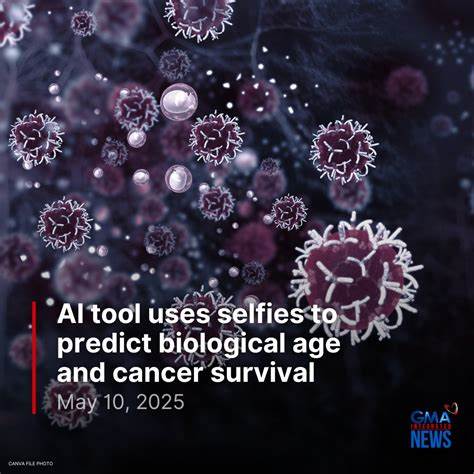Die Goldene Eule Schatzsuche hat über Jahrzehnte hinweg zahlreiche enthusiastische Schatzjäger angezogen und eine Gemeinschaft geschaffen, die sich akribisch mit den Hinweisen und Hinweiskombinationen beschäftigt. Das Besondere an diesem Schatzsuchspiel ist nicht nur die Herausforderung, sondern auch die mysteriöse Aura, die sich um die sogenannten elf offiziellen Rätsel und die vielleicht existierende zwölfter, sogenannte „Supersolution“, rankt. Die Debatte darüber, ob es einen zusätzlichen letzten Hinweis gibt, der das genaue Versteck offenbart, hat die Szene jahrzehntelang beschäftigt und spaltet bis heute die Meinungen der „Owler“, wie sich die Jäger nennen. Im Zentrum dieser Diskussion steht Michel Becker, der 2021 die Lösung beanspruchte und eine neue Perspektive auf die Schatzsuche eröffnete. Seine Erkenntnisse widersprechen der weit verbreiteten Annahme, dass es eine geheime zwölfte Lösung gebe, die den exakten Fundort markiert und überreste der vorherigen Hinweise – sogenannte „Reste“ – beinhaltet.
Die herkömmliche Vorstellung der Gemeinschaft basierte darauf, dass der französische Autor Max Valentin elf Hinweise geschaffen hat, welche die Suchenden zunächst auf eine allgemeine Region hinweisen, mit einem versteckten zwölften Hinweis, der präzise angibt, wo gegraben werden muss. Diese Überreste, wie Reste von Puzzleteilen, sollten den genauen Ort zwischen den historischen, geografischen und symbolischen Elementen enthüllen. Max Valentin selbst hatte angedeutet, dass nach dem Auflösen der elf Rätsel bestimmte Elemente übrigbleiben würden – dies waren die „Reste“, die beim letzten Schritt zur genauen Stelle hilfreich sein sollten. Doch bis zur Lösung blieb dies nebulös, und die Schatzjäger verbrachten Jahrzehnte damit, die Verbindungen zu entschlüsseln und die Hinweise minutiös zu analysieren, ohne den Schatz tatsächlich zu bergen. Mit Michel Beckers Veröffentlichung änderte sich die Perspektive grundlegend.
Becker erklärte, dass der Mythos um einen zwölften Hinweis beziehungsweise einer geheimen „Supersolution“ irreführend sei. Seiner Auffassung nach findet sich mit dem neunten Hinweis bereits die Region, in der der Schatz liegt. Die letzten beiden Hinweise, also Nummer zehn und elf, beinhalten keine bloßen Überreste oder verschleierte Botschaften, sondern geben die klaren Anweisungen, wo genau gegraben werden muss. Diese Interpretation brachte eine völlig neue Dynamik in die Schatzjagd, löste aber auch viel Skepsis aus. Besonders die Tatsache, dass Becker am Ort Dabo keinen Bronze-Eulenfund unter der rechten Statue entdeckte, sondern statt dessen lediglich eine Metallente in einem Beutel fand, sorgte für erhebliche Diskussionen.
Die historische Erklärung war, dass Max Valentin das ursprüngliche Eulenobjekt während einer schwierigen Phase, als der Verlag Insolvenz anmeldete und der Schatz von Insolvenzverwaltern beschlagnahmt wurde, entfernt habe – wohl um den Schatz vor dem Zugriff zu schützen. Dass das Original nie zurückgebracht wurde, unterstreicht die Tragik im Hintergrund dieser Geschichte. Die Kombination aus Beckers neuem Lösungsansatz und den ungelösten Fragen um den fehlenden physischen Schatz führt zu einer tiefgreifenden Spaltung in der Suchergemeinschaft. Viele Anhänger der ursprünglichen Theorie sehen den Fundort Dabo als zu einfach an und zweifeln an der Authentizität der Lösung. Doch die Tatsache, dass vier verschiedene Hinweise tatsächlich auf Dabo verweisen, kann kaum ignoriert werden.
Im Gegenteil – Becker weist darauf hin, dass die vermeintlich zu einfache Lösung oft genau das ist, was die Schatzsuche so komplex erscheinen ließ: Die Suchenden übersahen aufgrund ihrer Erwartungshaltung den grundsätzlich klaren Ort. Ein zentrales Element der Debatte Dreht sich um das Verstehen der „Reste“ und wie sie in den Hinweisen versteckt sind. Max Valentin hatte bewusst Elemente in den einzelnen Hinweisen verteilt, die als „Überbleibsel“ interpretiert werden können. Diese Reste können sich im Titel, im Text oder in Bildern widerspiegeln. Der springende Punkt ist, dass nicht alle Rätsel solche Überbleibsel enthalten, einige mehrere, andere gar keine.
Dieser Aspekt macht die Interpretation komplex und lässt Raum für unterschiedliche Lesarten. Wichtig ist auch die Erkenntnis, wann und wie man von der Kartierung auf der großen Michelin-Karte 989 zu den präzisen Messungen vor Ort wechselt. Max Valentin wollte offenbar, dass alle elf Hinweise zusammen wirksam sind, um so die Region eindeutig einzugrenzen. Doch wann der genaue Punkt für das Graben ermittelt wird, blieb in der Anleitung bewusst vage. Die letzte Phase der Schatzsuche verlangt vom Suchenden, die Hinweise als Gesamtsystem zu verstehen: Erst wenn die Region gefunden ist, eröffnen die Schritte der finalen Hinweise den exakten Standort.
So etwa wird die Kirche Saint Léon in Dabo zu einem entscheidenden Referenzpunkt. Die Richtung, Distanz und Bezugspunkte auf der Karte, etwa die drei „Borne Saint-Martin“-Steine, bilden zusammen ein Geodreieck, zwischen dem der Sucher den Mittelpunkt triangulieren muss. Gerade die Dreiecksgeometrie, der Einsatz von Kompass und Winkeln, die in den Rätseln angedeutet sind, spielen eine essenzielle Rolle. Die Hinweise selbst enthalten sogar Anspielungen auf Begriffe wie „Himmel“ und „Ewigkeit“ sowie subtile Verweise auf historische Symbole wie Rolands Schwert, die sich interpretativ auf das Suchen und Finden beziehen. Ein weiterer kritischer Punkt ist der Übergang vom großen Kartenausschnitt auf die lokale Karte.
Die Hinweise spielen mit der falschen Fährte, dass die Zahlen und Entfernungen möglicherweise nur als Gruppe auf der Michelin 989 Karte Sinn ergeben, doch eigentlich müssen sie in kleinerem Maßstab und lokal angewandt werden. Die Behauptung von Becker dazu ist, dass viele vermeintliche Überreste und Rätsel nur dann ihre Funktion erfüllen, wenn man sie vor Ort im richtigen Kontext deutet. Viele Schatzsucher zeigten sich enttäuscht über die offensichtliche Einfachheit dieser finalen Lösung. Jahrzehntelang war das Gefühl, dass hinter jedem Hinweis neue Geheimnisse verborgen sein müssten. Eine der größten Lektionen aus der Goldenen Eule Schatzsuche ist wohl, dass Einfachheit und Genialität manchmal Hand in Hand gehen können – Vieles, was verzwickt wirkt, ist oft eine raffinierte Irreführung, die Suchenden die wahre Antwort zu verschleiern.
Nicht zuletzt trägt die Tatsache, dass die ursprüngliche Bronze-Eule nicht mehr gefunden wurde und durch eine neue ausgetauscht wurde, eine geheimnisvolle Note in die Geschichte. Ob Max Valentin selbst daran beteiligt war oder sein enger Vertrauter Phil D’Euck, bleibt unklar. Diese andauernde Unsicherheit erfüllt die Schatzsuche mit einer unerschöpflichen Faszination. Eine abschließende Überlegung bleibt jener Hinweis des allerersten Rätsels, dessen Titel lautet „Es gibt keinen, der blind ist, außer dem, der nicht sehen will.“ Diese Aussage fasst zusammen, wie schwer es manchmal ist, das Offensichtliche zu erkennen, wenn man es intuitiv auszuschließen versucht.