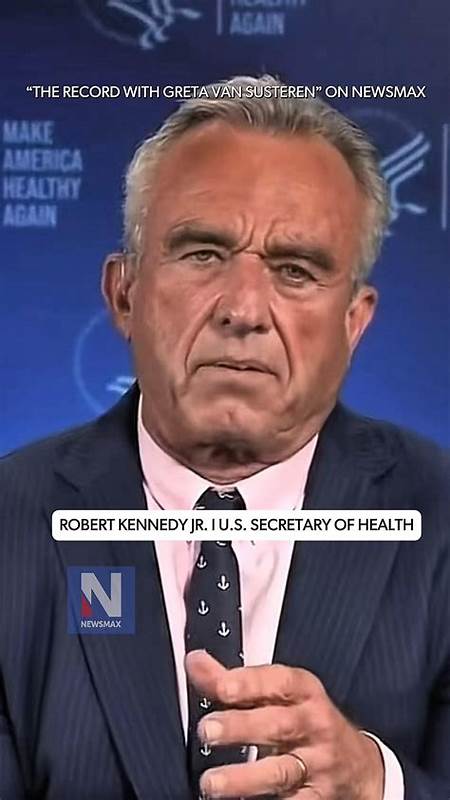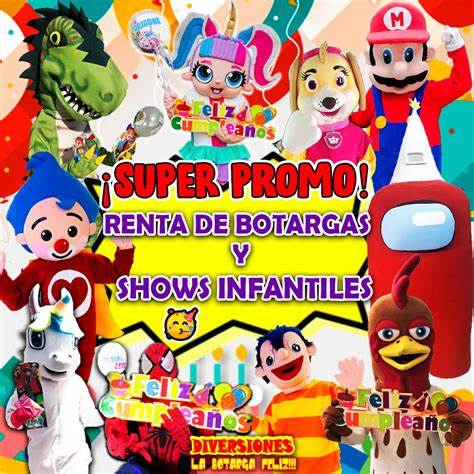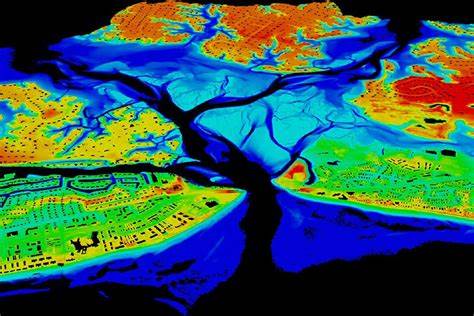Open Source ist längst weit mehr als nur der Austausch von Quellcode. Es ist eine lebendige Bewegung, die Menschen weltweit verbindet, Wissen teilt und Innovationen fördert. Kriti Godeys Weg in diese Welt zeigt, wie sich Leidenschaft, Lernen und gemeinschaftliches Arbeiten zu einer kraftvollen Kombination entwickeln können, die weit über die reine Softwareentwicklung hinausgeht. Ihr Werdegang bietet einen faszinierenden Einblick in die Herausforderungen und Erfolge, die der Einstieg in Open Source mit sich bringt, sowie in die neuen Verantwortlichkeiten, die eine Führungsrolle in diesem Umfeld mit sich bringt. Kriti Godey begann ihre Karriere als Softwareingenieurin vor fast fünfzehn Jahren.
Wie bei vielen, die heute im Open-Source-Bereich aktiv sind, war ihr Einstieg eher zufällig. Als sie mit 19 Jahren Informatik studierte und nach praxisorientierter Erfahrung suchte, ergab sich für sie eine Gelegenheit, mit einer Open-Source-basierenden Content-Management-System (CMS)-Lösung auf Basis von Django zu arbeiten. Diese Erfahrung war für sie ein entscheidender Wendepunkt. Sie lernte nicht nur die technische Seite kennen, sondern wurde auch erstmals mit der Philosophie und den Mechanismen von Open Source vertraut. Faszinierend war für sie vor allem die ausführliche Dokumentation und die gemeinschaftliche Arbeitsweise.
Das Konzept, dass Menschen detaillierte Anleitungen gemeinsam erstellen, nur damit andere davon profitieren können, hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihr. Sie erkannte damals noch nicht, dass sie sich auf einem Pfad befand, der sie eines Tages dazu bringen würde, aktiv Stilrichtlinien für Open-Source-Projekte zu schreiben und als Maintainer zu fungieren. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Kriti intensiv mit Django und verschiedenen anderen Bibliotheken, was sie dazu brachte, regelmäßig den Quellcode zu studieren. Oft blieben Dokumentationen hinter den Anforderungen zurück, was sie antrieb, selbst tiefer in die technischen Details einzutauchen. Diese intensive Auseinandersetzung führte dazu, dass sie nicht nur Fehler entdeckte, sondern sich auch an Mailinglisten beteiligte und wichtige Kommunikationsmittel innerhalb der Gemeinschaft nutzte, wie Bugtracker und IRC-Kanäle.
Diese Erfahrung war durchaus herausfordernd, aber sie legte die Basis für ihr Verständnis der Open-Source-Dynamik. Der erste Schritt, sich selbst als aktive Mitwirkende im Open Source zu sehen, war für Kriti ein einfacher, doch bedeutender Moment. Sie korrigierte einen falsch verwendeten Begriff in der Dokumentation einer Bibliothek, die sie nutzte, und reichte eine Pull-Request (PR) ein. Die schnelle und positive Rückmeldung des Maintainers war für sie eine Bestätigung und eine große Motivation. Dieser Austausch sorgte dafür, dass sie sich zunehmend als Teil der Open-Source-Gemeinschaft wahrnahm, auch wenn sie anfänglich nicht bewusst „dazugehörte“.
Die Jahre vergingen, und Kriti knüpfte durch Konferenzen wie PyCon und DjangoCon wertvolle Kontakte zu anderen Maintainerinnen und Maintainer. Diese Begegnungen, auch die kurzen Momente, in denen sie Persönlichkeiten wie Guido van Rossum traf, verstärkten ihre Begeisterung für Open Source. Außerdem öffnete sie sich für verschiedene Perspektiven auf die Entwicklungsprozesse und die gemeinschaftlichen Strukturen hinter erfolgreichen Projekten. Dabei wurde klar, dass nicht nur Code, sondern auch Dokumentation, Community-Management und Offenheit entscheidend für den Erfolg sind. Im Jahr 2018 stellte sich für Kriti eine wichtige Möglichkeit dar: Sie wechselte zu Creative Commons, einer Organisation, die Wissen freier zugänglich machen möchte.
Ihr Auftrag war zunächst technisch geprägt, doch sie nutzte die Chance, eigene Ideen zur Verbesserung von internen Tools und Bibliotheken einzubringen und umzusetzen. In den folgenden Jahren gelang es ihr und ihrem Team, zahlreiche Repositorien aufzuräumen, neue Projekte herauszubringen und ein System für Contributors aufzubauen. Dabei wurde ihr bewusst, dass Software nur ein Teil des Ganzen ist. Erfolgreiche Open-Source-Projekte erfordern auch gute Dokumentation, schnelle Reaktionszeiten auf Beiträge, eine Top-Onboarding-Erfahrung sowie sichtbare und transparente Abläufe, die Menschen zum Mitmachen einladen. In ihrer Rolle vertrat sie Creative Commons auch bei der Open Source Initiative, wo sie Maintainer aus aller Welt kennenlernte und sich austauschen konnte.
An einem Punkt wurde ihr klar, dass sie inzwischen selbst zu dieser Gruppe von Maintainerinnen gehört – ein Meilenstein, der den Bedeutungswandel ihrer Arbeit unterstreicht. Ein bedeutender Schritt im Jahr 2020 war die Umstrukturierung bei Creative Commons, die Kriti dazu brachte, ihr Augenmerk auf ein neues Projekt zu richten: Mathesar. Dieses Projekt war das Ergebnis eines Grants und der Idee, eine intuitive Benutzeroberfläche für den Umgang mit Postgres-Datenbanken zu schaffen – und zwar für Nicht-Technikerinnen und Nicht-Techniker. Die Erfahrungen bei Creative Commons flossen in alle Aspekte von Mathesar ein: klare, anfängerfreundliche Issue-Labels, schnelle Review-Prozesse, öffentlich zugängliche Spezifikationen und Design-Diskussionen sowie eine „offene“ Teamkommunikation über eine öffentliche Matrix-Chat-Plattform. Das Ziel war es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen aller Hintergründe sich willkommen fühlen.
Ein eigenes Projekt von Grund auf aufzubauen bedeutet, eine neue Kultur zu schaffen. Kriti musste eine technische Identität formulieren, Prozesse für Beiträge etablieren und einen kontinuierlichen Feedback- und Ideenfindungszyklus initiieren. Dies geschah transparent und mit freiwilligen Beiträgerinnen aus der ganzen Welt. Klar wurde sehr schnell, dass die Leitung eines solchen Projekts nicht nur technisches Know-how verlangt, sondern auch Führungsfähigkeiten, Empathie und Organisationsgeschick. Bis zur Veröffentlichung der Alpha-Version im Jahr 2023 zeigte sich, wie umfangreich das Unterfangen wirklich war und welche kontinuierlichen Herausforderungen die langfristige Pflege der Codebasis und der Community mit sich bringt.
Um den Fortbestand und die Nachhaltigkeit von Mathesar zu sichern, wurde die Mathesar Foundation gegründet, unterstützt unter anderem von bekannten Persönlichkeiten der Tech-Branche. Kriti übernahm dort die Rolle der Geschäftsführerin und leitenden Maintainerin. Mittlerweile verbringt sie weniger Zeit mit klassischer Softwareentwicklung, sondern mehr mit strategischer Planung, Produktentwicklung und Fundraising. Ihr Fokus liegt darauf, Mathesar als Open-Source-Projekt nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch auf eine solide Basis zu stellen – und dies ohne Kompromisse bei der Offenheit und Selbsthosting-Fähigkeit des Tools einzugehen. Mathesar unterscheidet sich inhaltlich von vielen Open-Source-Projekten, die vornehmlich für Entwicklerinnen und Entwickler gemacht sind.
Ziel ist eine nutzerfreundliche Infrastruktur, die die Leistungsfähigkeit von Postgres mit der Benutzerfreundlichkeit von Werkzeugen wie Airtable verbindet. Dieses Engagement zeigt eindrucksvoll, wie Open Source auch Endanwenderinnen und Endanwender erreichen und Mehrwert bieten kann. Doch auch nach so vielen Jahren in der Community bleiben Herausforderungen bestehen. So sorgte etwa die Umstellung der GitHub-Issue-Labels auf die neuen Issue-Typen für unerwartete Probleme, die zeigten, wie sensibel und komplex die Arbeit im Open-Source-Ökosystem sein kann. Schnell wurde klar, dass Änderungen immer gut abgestimmt und kommuniziert werden müssen, um die Zusammenarbeit nicht zu gefährden.
Kritis persönliche Reflektionen unterstreichen die einzigartigen Qualitäten von Open Source: die grundsätzliche Offenheit, das Wegfallen von Barrieren und die Möglichkeit, Wissen und Werkzeuge einer breiten Öffentlichkeit kostenlos zugänglich zu machen. Gerade die Geschichten von Nutzerinnen und Nutzern, die dank Mathesar oder anderen Projekten genau das fanden, was sie suchten, sind für sie die wertvollsten Momente. Abschließend gibt Kriti auch einen Ausblick auf die Möglichkeiten und Herausforderungen, die durch Künstliche Intelligenz (KI) entstehen. Ihrer Einschätzung nach kann KI die Arbeit von Maintainerinnen sowohl erschweren als auch erleichtern. Automatisierte, wenig durchdachte PRs könnten eine Belastung darstellen, während KI-gestützte Tools bei der Dokumentation, dem Bug-Triage oder der Qualitätssicherung unterstützen können.