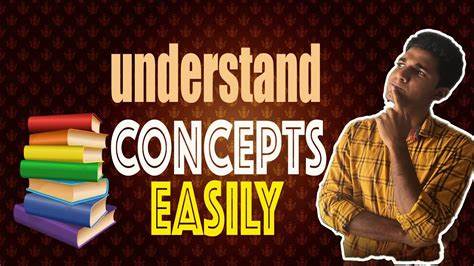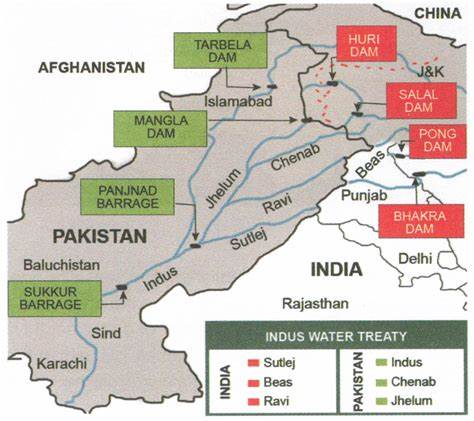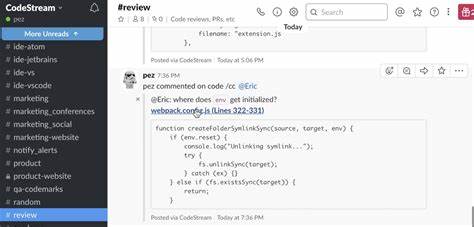Die Tanzmanie, auch bekannt als Tanzplage oder Choreomanie, ist ein rätselhaftes soziales Phänomen, das vor allem in Europa zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert auftrat. Es handelt sich um eine mysteriöse Erscheinung, bei der große Gruppen von Menschen – teilweise mehrere Hundert oder sogar Tausende – unkontrolliert und anhaltend tanzten, bis sie sowohl vor Erschöpfung zusammenbrachen als auch Verletzungen erlitten oder sogar verstarben. Trotz der zahlreichen dokumentierten Fälle bleibt die tatsächliche Ursache bis heute eine der großen unbekannten Rätsel historischer Medizin und Gesellschaft.
Die folgende Betrachtung beleuchtet die Historie, Charakteristik, akademische Theorien und kulturellen Kontexte der Tanzmanie, die bis heute Wissenschaftler, Historiker und Psychologen gleichermaßen fasziniert und herausfordert. Die Ursprünge und größte Ausbreitung der Tanzmanie lassen sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen, wobei eines der ersten großen dokumentierten Ereignisse im Jahr 1374 in Aachen stattfand. Das Phänomen weitete sich rasch in der Region des Heiligen Römischen Reiches aus, mit weiteren bedeutenden Ausbrüchen in Städten wie Köln, Straßburg und Metz. Die wohl bekannteste Episode wird als Tanzplage von 1518 bezeichnet, bei der in Straßburg binnen kürzester Zeit bis zu 400 Menschen anhaltend tanzten, bis einige von ihnen starben.
Über mehrere Jahrhunderte hinweg wurden diese Ereignisse immer wieder beobachtet und notiert, doch verblieben sie für Zeitgenossen oftmals ein unbeherrschbares und bedrohliches Geschehen. Charakteristisch für die Tanzmanie war das scheinbar unkontrollierte und ausdauernde Tanzen, das von außen betrachtet wie ein Zustand geistiger Umnachtung oder gar Besessenheit wirkte. Betroffene Menschen schienen in einer Trance zu sein, unfähig ihren Bewegungen nach eigenem Willen Einhalt zu gebieten. Die Dauer der Tanzanfälle war oft erschreckend lang und reichte von Stunden über Tage hinaus bis hin zu mehreren Wochen und in Extremfällen sogar Monaten. Die Ausbreitung erfolgte oft in kleineren Gruppen innerhalb von Familien oder Nachbarschaften, konnte sich aber auch wie eine Art „sozialer Virus“ durch ganze Gemeinden oder gar Regionen ausdehnen.
Entgegen moderner Vorstellungen waren es keineswegs nur Frauen, die betroffen waren. Zeitgenössische Aufzeichnungen belegen, dass Männer, Frauen und Kinder zu den Tänzenden gehörten. Auch wenn die Motive der Beteiligten nicht abschließend geklärt sind, so ist sicher, dass sich einige Menschen durch die Rituale selbst heilenden oder befreienden Charakter zuschrieben. Muslimische und christliche Pilgerfahrten zu Kirchen und Kapellen waren häufiges Ziel der Tänzer, die an den Schutz bestimmter Heiliger glaubten. Besonders der Heilige Vitus und der Heilige Johannes wurden hier mit der Tanzmanie in Verbindung gebracht; aus diesem Zusammenhang heraus erhielt das Phänomen auch die Bezeichnungen „St.
Vitus’ Tanz“ oder „St. Johannes Tanz“. Im Mittelalter wurde der Zustand vielfach als Fluch oder göttliche Strafe interpretiert. Man glaubte, eine höhere Macht oder Dämonen wären verantwortlich, weshalb exorzistische Maßnahmen oder Gebete häufig angewandt wurden. Paradox war, dass Musiker und Musik häufig zur Behandlung oder Beruhigung der Tänzer eingesetzt wurden, was sich jedoch oftmals als kontraproduktiv erwies, da die musikalische Untermalung neue Menschen anzog und das Phänomen verstärkte.
Das führte gar soweit, dass eigens Tanzplätze und Musikeinrichtungen errichtet wurden, um die betroffenen Gemeinschaften zu kontrollieren oder zu isolieren. Die komplexen und teils widersprüchlichen Symptome der Tanzmanie erschwerten eine klare medizinische Einordnung. Einige Studien verglichen das Phänomen mit heutigen neurologischen oder psychischen Erkrankungen wie Sydenham-Chorea, einer Nervenkrankheit, die zu unwillkürlichen Bewegungen führt, oder mit Formen der Epilepsie. Andere Theorien schlagen Vergiftungen durch Mutterkornpilz vor, der in feuchtem Getreide wachsen kann und halluzinogene und krampfartige Reaktionen hervorrufen kann; dieser Zustand wird auch als Ergotismus bezeichnet und war im Mittelalter verbreitet. Der berühmte Neurologe Oliver Sacks beschäftigte sich mit diesen Hypothesen und vermutete einen Zusammenhang zwischen Ergotvergiftungen und ähnlichen Massenphänomenen, doch konnte diese Erklärung nicht alle Merkmale der Tanzmanie befriedigend abdecken.
Eine weitere Sichtweise geht von einer psychosozialen Ursache aus und erklärt die Tanzmanie als eine Form von Massenpsychose oder „Massenhysterie“. Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Not – wie etwa nach der Pest oder während kriegerischer Unruhen –, prägten Angst, Verzweiflung und soziale Spannungen das kollektive Bewusstsein. Das Tanzen kann hierbei als Ventil für inneren Druck, Stress und unterdrückte Emotionen verstanden werden. Menschen suchten auf diese Weise nicht nur Ablenkung, sondern auch ein Gefühl von Ekstase und Gemeinschaft. Die Tatsache, dass sich das Phänomen oft entlang von Handelswegen oder in städtischen Zentren mit regem Austausch zeigte, unterstützt die Theorie der sozialen Ansteckung und der kulturellen Übertragung.
Eng verbunden mit der Tanzmanie ist das Phänomen der Tarantismus, das vor allem in Italien und Südspanien bekannt war. Dort glaubte man, dass der Biss einer Tarantel oder einer ähnlich giftigen Spinne die Ursache für plötzliche, heftige Tanzanfälle sei. Die Heilung bestand darin, sich durch Tanz und Musik von dem Gift zu befreien und den Körper wieder zu reinigen. Während dieser Zeit entwickelte sich der berühmte „Tarantella“-Tanz. Im Gegensatz zur eher unkontrollierten und teils chaotischen Tanzmanie waren die musikalisch begleiteten Tänze des Tarantismus ritualisiert und hatten einen festen Ablauf und Zweck.
Historische Berichte aus dem 16. und 17. Jahrhundert berichten immer wieder von lang anhaltenden Tanzritualen vor Kirchen, insbesondere vor denen, die dem Heiligen Vitus geweiht waren. Berühmte Persönlichkeiten wie Gregor Horst beschrieben Tanzveranstaltungen, bei denen Frauen tage- oder monatelang ekstatisch und scheinbar besessen in der Nähe religiöser Stätten verharrten. Dieses Verhalten hatte manches Mal eine Art kultischen Charakter, und es wird spekuliert, dass Reste vorchristlicher Bräuche in der europäischen Volkskultur durch diese scheinbare „Tanzmanie“ weiterlebten.
Die Reaktionen der Gesellschaft auf die Tanzmanie waren vielschichtig und von Unwissenheit geprägt. In einer Zeit, in der Wissenschaft und Medizin noch in den Kinderschuhen steckten und seelische Erkrankungen kaum verstanden wurden, versuchte man mit Glauben, Ritualen und Sprichwörtern Antworten zu finden. Isolation, Gebet, Pilgerfahrten und Exorzismen waren gängige Mittel, auch wenn sich deren Wirksamkeit als begrenzt erwies. Im Gegenteil, manchmal förderten die bestehenden Überzeugungen das Ausmaß der Tanzmanie und verlängerten dadurch das Leiden der Betroffenen. Heute wird Tanzmanie oft als früher dokumentierter Fall von „mass psychogenic illness“ betrachtet – einem medizinischen Begriff, der kollektive körperliche Symptome beschreibt, die keine organische Ursache haben, sondern durch soziale und psychische Faktoren ausgelöst werden.
Die Erforschung solcher Phänomene ist insbesondere für Psychologen, Soziologen und Historiker wichtig, da sie Einblick in den Einfluss gesellschaftlicher und kultureller Dynamiken auf die menschliche Psyche gibt. Das faszinierende an der Tanzmanie bleibt der Umstand, dass sie nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein kulturelles und soziales Phänomen war. Sie verdeutlicht, wie eng psychische Gesundheit und gesellschaftliches Umfeld miteinander verflochten sind. Zugleich hat die Tanzmanie in Kunst, Literatur und Film immer wieder Inspiration gefunden – von den Zeichnungen Pieter Brueghels bis zu heutigen Interpretationen in Romanen und historischen Darstellungen. Zusammenfassend ist die Tanzmanie eine der rätselhaftesten Epidemien des europäischen Mittelalters, deren Ursachen vermutlich in einem komplexen Geflecht von Temperament, sozialer Notlage, religiösem Glauben und kultureller Überlieferung liegen.
Obwohl sich moderne Medizin und Psychologie weit von den mittelalterlichen Vorstellungen entfernt haben, bleibt die Tanzmanie ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie menschliche Gemeinschaften auf extreme Belastungen reagieren können und wie sich kollektive Verhaltensweisen in besonderen historischen Kontexten formen. Die Erforschung dieses Phänomens trägt nicht nur zum besseren Verständnis der Vergangenheit bei, sondern bietet auch spannende Einsichten in die Mechanismen sozialer Ansteckung und die Kraft des menschlichen Geistes.