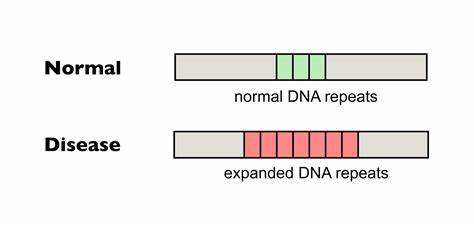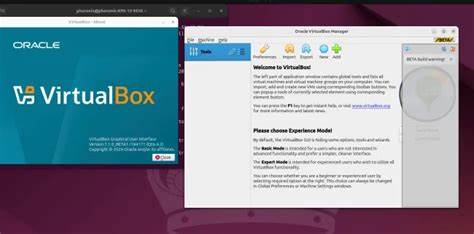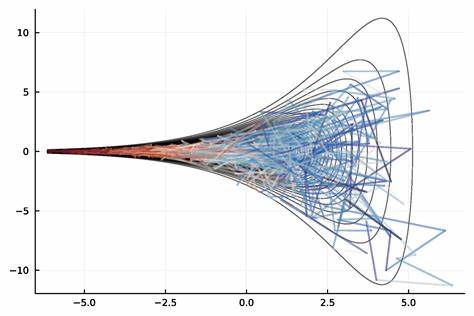Tox galt über viele Jahre hinweg als eines der wichtigsten Werkzeuge für das Testen und Managen von Python-Projekten. Es hat sich einen Namen gemacht durch die einfache Erstellung und Verwaltung isolierter virtueller Umgebungen, die Installation von Abhängigkeiten und die Ausführung unterschiedlicher Tests in verschiedenen Python-Versionen. Für etwa 15 Jahre war Tox aus der Python-Entwicklung kaum wegzudenken. Doch das Entwickler-Ökosystem hat sich deutlich weiterentwickelt – und mittlerweile fällt es schwer, an der einen oder anderen Stelle den bekannten Tox-Workflow aufrechtzuerhalten, ohne an Geschwindigkeit, Effizienz und Flexibilität einzubüßen. Tox trennt zwei Aufgaben, die nicht unbedingt zusammengehören: die Virtual Environment-Verwaltung und das Task-Running.
Das Tool erzeugt für jede Aufgabe ein separates virtuelles Umfeld, in dem die jeweiligen Abhängigkeiten installiert werden. So entsteht zum Beispiel für „Linting“ ein eigenes Environment, ein anderes für Unit-Tests oder Typprüfung. Die Idee dahinter ist klar: Isolierung, die verhindert, dass sich unterschiedliche Testläufe gegenseitig beeinflussen. Gleichzeitig sorgt Tox damit aber auch für eine Verdopplung beziehungsweise Vervielfachung von Abhängigkeiten und Umgebungen, was sich vor allem bei umfangreichen Projekten mit großen Abhängigkeitssätzen negativ bemerkbar macht. Der Installationsaufwand steigt, und die Zeit für Setup und Tests wächst.
Hinzu kommt ein weiterer bedeutender Nachteil: Die Abhängigkeitsverwaltung bei Tox ist im Gegensatz zu moderneren Python-Tools vergleichsweise wenig automatisiert. Manuelle Pflege von Constraint- oder Requirements-Dateien ist oft nötig, um widersprüchliche oder überholte Pakete zu vermeiden. Tox integriert sich nicht naturnah in die gängigen Standard-Dateien wie pyproject.toml, die heute zentrales Element vieler Python-Projekte sind. Zwar wurde in den letzten Monaten eine Erweiterung eingeführt, die es erlaubt, dependency groups entsprechend PEP 735 zu verwenden und damit doppelten Pflegeaufwand zu reduzieren, doch viele Nutzer werden darauf erst umsteigen, wenn diese Neuerung breitere Akzeptanz findet.
Die Folge ist, dass Tox-Umgebungen sich leicht von der lokalen Entwicklerumgebung oder von den eigentlichen Arbeitsumgebungen in IDEs entfernen. Das führt dazu, dass Auto-Vervollständigung, statische Codeanalyse oder automatische Formatierung in der Entwicklungsumgebung nicht mehr optimal funktionieren – weil die Abhängigkeiten, die in Tox getrennt verwaltet werden, einfach fehlen oder in anderen Versionen vorliegen. Diese Entkopplung der Entwicklungs- von den Testumgebungen erschwert eine effiziente und reibungslose Entwicklungspraxis. In diesem Kontext haben sich alternative Werkzeugketten etabliert, die weniger auf die Aufspaltung und Isolation setzen und stattdessen auf eine engere Verzahnung von Versionsmanagement, Abhängigkeitsverwaltung und Task-Ausführung bauen. Poetry und uv stechen besonders hervor.
Beide Tools übernehmen sowohl das Management virtueller Umgebungen als auch die paketbezogene Abhängigkeitsverwaltung weitgehend automatisch und modern. Poetry hat sich in den letzten Jahren einen Namen als umfassendes Python-Projektmanagement-Tool gemacht, dessen Schwerpunkt neben venv-Verwaltung auch auf der Automatisierung von Paketinstallation, Build-Prozessen und Veröffentlichung liegt. Uv dagegen ist ein jüngerer Kandidat, der einen etwas leichteren, standardkonformer ausgerichteten Ansatz verfolgt und gleichzeitig Funktionen eines Python-Versionmanagers wie pyenv integriert. Wer Poetry oder uv verwendet, hat den großen Vorteil, dass alle Abhängigkeiten und die darauf aufbauenden Werkzeuge in einer einzigen Umgebung verwaltet werden. Die handhabbare Einheitlichkeit erleichtert alle nachfolgenden Entwicklungsprozesse und automatisiert auch die Synchronisierung der Abhängigkeiten mit pyproject.
toml oder anderen Standarddateien. Es wird nicht länger nötig, ständig mehrere parallele virtuelle Umgebungen zu erschaffen, was eine erhebliche Zeitersparnis mit sich bringt und Ressourcen schont. Vor diesem Hintergrund wird Tox im Tagewerk vieler Entwickler praktisch zum reinen Task-Runner reduziert. Doch die Erfahrung zeigt, dass Tox als Task-Runner nicht besonders komfortabel ist. Seine Konfiguration für neue Aufgaben ist vergleichsweise aufwendig und starr, die Notwendigkeit, explizit Abhängigkeiten pro Aufgabe anzugeben oder die dauerhafte Erzeugung neuer virtueller Umgebungen zu unterbinden, erschweren die Nutzung zusätzlich.
Man findet deshalb häufiger Workarounds wie Makefiles oder Shell-Skripte, um Befehle direkt über die bestehende venv auszuführen, was in vielen Fällen übersichtlicher und schneller ist. Eine sehr moderne und elegante Alternative ist hier das Tool Just. Der Just-Task-Runner entspricht in gewisser Weise einem schlanken, aufgabenorientierten Makefile, ohne dabei den Fokus auf das Überprüfen des Dateistatus zu legen. Just konzentriert sich rein auf die Ausführung von Befehlen, unterstützt die Abhängigkeit zwischen Aufgaben und kann mit System-Shells verknüpft werden. Durch die Integration mit Poetry oder uv wird jeder Task automatisch in der korrekten virtuellen Umgebung ausgeführt und spart sich das mühselige Voranstellen von Kommandozeilenpräfixen wie „poetry run“ oder „uv run“.
Die Handhabung von Just ist vergleichsweise simpel. Ein justfile kann so formuliert werden, dass typische Entwicklungsaufgaben wie Linting, Typprüfung und Tests über einfach lesbare Rezepturen aufgerufen werden. Dabei werden alle relevanten Schritte durch wenige Zeilen geregelt, was die Wartbarkeit enorm vereinfacht. Wer einmal von konfigurationsschweren Tox-Umgebungen auf Just in Kombination mit Poetry oder uv umgestiegen ist, wird den Unterschied in Geschwindigkeit und Übersichtlichkeit deutlich spüren. In der Praxis lassen sich so CI-Prozesse deutlich beschleunigen – Berichte sprechen von bis zu 30 % schnellerer Ausführungszeit bei gleicher Funktionalität.
Ein weiterer Pluspunkt dieser Herangehensweise ist die flexible Steuerung der Python-Versionen, die zu Testzwecken eingesetzt werden. Während Tox traditionell Umweltmatrixen erzeugt, die verschiedenste Python-Versionen simultan testen, kann man bei Einsatz von uv mit seinem eingebauten Versionsmanagement gezielt einzelne Python-Versionen anwählen, auch wenn dies etwas mehr manuelle Steuerung erfordert. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Build-Pipelines gezielt auf bestimmte Python-Versionen fokussieren, die lokale Entwicklung bleibt hingegen mit einer Version möglichst einfach und effizient. Wer also heute im Python-Ökosystem unterwegs ist und den Aufwand bei der Qualitätssicherung sowie der Automatisierung von Entwicklungsprozessen reduzieren möchte, sollte Tox genau unter die Lupe nehmen und seine Notwendigkeit hinterfragen. Die Zeiten, in denen Tox das unangefochtene Schweizer Taschenmesser war, sind passé.
In einer modernen Toolchain mit Poetry oder uv gewinnt man nicht nur an Komfort, sondern auch an Performance und Flexibilität. Für Projekte, die wirklich komplexe Matrix-Tests benötigen, d. h. Testing an mehreren Python-Versionen und vielfältigen Abhängigkeitskombinationen, mag Tox weiterhin eine Rolle spielen. Doch in den meisten Fällen, vor allem bei lokal orientierter Entwicklung und schlanken Build-Pipelines, sind die Kombinationen Poetry plus Just beziehungsweise uv plus Just die bessere Wahl.
Sie sparen Zeit, Aufwand und sorgen für ein harmonischeres Zusammenspiel mit der Entwicklungsumgebung. Abschließend sei festgehalten: Der Umstieg von Tox auf zeitgemäße Lösungen erfordert natürlich eine kurze Lernphase und Anpassung der Build- sowie Testprozesse. Hat man ihn jedoch erst einmal hinter sich gebracht, eröffnen sich eine deutlich flüssigere Entwicklung, eine bessere Integration in moderne Editor-Setups und eine insgesamt schlankere Automatisierung. Deshalb lohnt es sich, über diesen Paradigmenwechsel nachzudenken und die Vorteile moderner Workflow-Werkzeuge für den eigenen Python-Code zu nutzen.
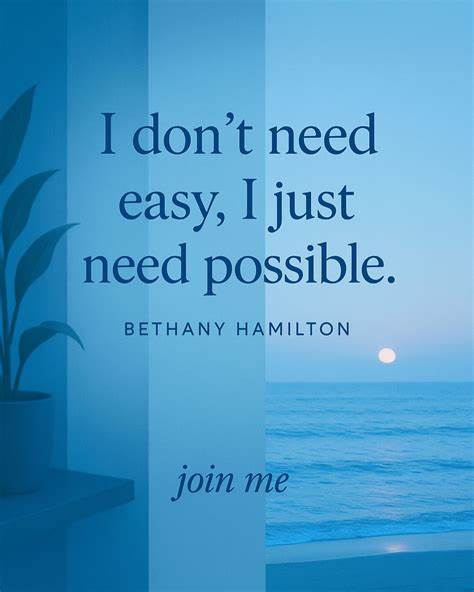


![Domain/OS Design Principles (1989) [pdf]](/images/1E5E6EAD-D0D8-4814-A356-4FED55AA17AE)