Damien Hirst, eine der schillerndsten und kontroversesten Figuren der zeitgenössischen Kunstwelt, überrascht immer wieder mit innovativen Konzepten und provozierenden Arbeiten. Bekannt wurde er vor allem durch seine Werke, die sich mit Leben, Tod und Vergänglichkeit auseinandersetzen – beispielhaft dafür ist sein berühmtes Werk „The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living“ mit einem in Formaldehyd konservierten Hai. Doch Hirst geht weit über die Grenzen traditioneller Kunstproduktion hinaus. Sein aktuellster bemerkenswerter Plan ist es, Kunst für 200 Jahre nach seinem Tod weiter zu schaffen. Dieses ambitionierte Vorhaben wirft fundamentale Fragen zur Zukunft der Kunst und der Rolle des Künstlers selbst auf.
Hirsts Idee, posthum weiter Kunstwerke zu produzieren, beruht auf einer innovativen Strategie: Er will 200 Notizbücher mit Zeichnungen und Anweisungen füllen – eines für jedes Jahr nach seinem Ableben. Diese Skizzen und Konzepte sollen es ermöglichen, dass seine Familie oder bevollmächtigte Nachfolger Kunstwerke in seinem Namen fertigen und verkaufen können. Dabei werden sie vom künstlerischen Geist Hirsts inspiriert, behalten aber gleichzeitig eine offizielle Legitimation. Die Werke sollen auf ihren jeweiligen Zeitraum datiert werden, sodass ein faszinierendes Narrativ über zwei Jahrhunderte entsteht. Das Konzept erinnert an etwas, das man aus der Finanzwelt kennt – konkret an den Handel mit Futures, also zukünftigen Verträgen auf den Erwerb von Rohstoffen.
In Hirsts Fall wäre dies die Produktion von Kunstwerken, deren Rechte vorab verkauft und gehandelt werden können. Dieses Modell steht nicht nur für eine finanzielle, sondern auch für eine kreative Innovation und stellt das traditionelle Verständnis von Kunstschaffenden und ihren Werken in Frage. Die Idee von posthumer Kunst ist keineswegs neu, doch keiner hat sie bisher so radikal und systematisch verfolgt wie Damien Hirst. Künstler wie Andy Warhol oder Jeff Koons haben mit kunstindustriellen Produktionsweisen bereits die Trennung zwischen künstlerischer Idee und handwerklicher Ausführung verwischt. Hirst wiederum erweitert diesen Gedanken um die Dimension der Zeit, die über den Tod hinausgeht.
Er betrachtet sein Werk als eine Art von lebendigem Unternehmen, das weit über ihn persönlich hinaus Bestand haben soll. Dieser Ansatz führt uns zu wesentlichen Fragen über Authentizität und Urheberschaft: Was bedeutet es heute, wenn Kunstwerke autorisiert, aber noch im Entstehungsprozess von anderen Personen gefertigt werden? Wie viel künstlerische Kontrolle behält der Künstler, wenn er physisch nicht mehr anwesend ist? Hirst adressiert diese Themen auf direkte Weise, indem er für sich eine Art künstlerisches Testament erstellt, das die Produktion und die Signierung von Kunstwerken durch seine Nachkommen ermöglicht. Dadurch wird die Linie zwischen originaler Schöpfung und autorisierter Reproduktion aufgebrochen und neu definiert. Der Kunstmarkt und Hirsts Rolle darin sind zentral für das Verständnis dieses Projektes. Der britische Künstler gilt als einer der kommerziell erfolgreichsten lebenden Künstler.
Seine Werke erzielen regelmäßig Millionenbeträge, und er war einer der ersten, der mit innovativen Verkaufsstrategien experimentierte, etwa als er 2008 seine Kunstwerke direkt bei Sotheby’s versteigerte und so einen der größten Kunstverkäufe aller Zeiten erzielte. Sein Geschäftssinn zeigt sich auch darin, wie er das Thema Vergänglichkeit seines Werks neu denkt. Statt sich allein auf den Wert und die Seltenheit seiner Werke zu stützen, sucht Hirst nach neuen Wegen, seine Kunst auf lange Sicht relevant und kommerziell erfolgreich zu halten. Eine weitere interessante Facette seiner Lebens- und Arbeitsweise ist der Umgang mit Assistenz und Produktion. Anders als viele Künstler, die ihre Werke persönlich erschaffen, beschäftigt Hirst ein großes Team von Mitarbeitern und Handwerkern.
Diese Künstlerfabrik ist Teil eines bewussten Konzepts, das die Entstehung von Kunst als kollektiven Prozess versteht, in dem seine eigene Rolle als ideengebender Direktor zentral bleibt. Mit Fokus auf posthume Kunst macht er diesen Prozess auf lange Sicht unabhängig von seiner eigenen physischen Anwesenheit. Hirsts Plan, Kunst für zwei Jahrhunderte nach seinem Tod zu produzieren, ist auch eine Auseinandersetzung mit der Zeit an sich. Das Bewusstsein für die eigene Sterblichkeit prägt sein Werk seit Jahren, und dieses Projekt scheint eine Art künstlerischer Versuch zu sein, den Tod zu überwinden. Anders als viele seiner Kollegen setzt er nicht auf das isolierte Kunstwerk als bleibenden Wert, sondern auf eine sich stetig entfaltene Produktauswahl, die den Dialog zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufrechterhält.
Diese Vision stellt konventionelle Denkweisen von Kunstangebot und Kunstbewertung infrage. Sie lädt ein, den Begriff von Einzigartigkeit neu zu diskutieren. Wenn Werke über einen Zeitraum von Jahrhunderten nach Anweisungen des Künstlers geschaffen werden können, verschiebt sich der Schwerpunkt von körperlicher Originalität auf inhaltliche und konzeptuelle Kontinuität. Für Kunstsammler und Institutionen bedeutet das eine völlig neue Herangehensweise an Kunstwerke, die nicht mehr allein als statische Objekte, sondern als Teile eines laufenden Prozesses verstanden werden müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der Nachkommen und des Erbes.
Hirst scheint sich aktiv mit der Verantwortung auseinanderzusetzen, die er seiner Familie gegenüber hat. Die Möglichkeit für seine Kinder oder Enkelkinder, im Rahmen seiner Anleitungen weiterhin Kunst zu schaffen und zu signieren, verbindet persönliche Bindungen mit professionellen und kommerziellen Interessen. Dieses Erbe-Modell kann Beispielwirkung für andere Künstler haben, die sich fragen, wie ihre Kunst auch lange nach ihrem Tod präsent und lebendig bleibt. Kritiker werden sicherlich anmerken, dass Hirsts Konzept auch Risiken in sich trägt. Die Gefahr von Überproduktion, Qualitätsverlust oder der Verwässerung des eigenen künstlerischen Anspruchs ist real.
Dennoch zeigt sein Vorhaben, wie sich Kunst in einer digitalisierten und globalisierten Welt neu erfinden kann. Es offenbart das Potential von innovativen Denkansätzen jenseits traditioneller Grenzen — im Spannungsfeld zwischen Kunst, Kommerz und Technologie. Darüber hinaus fügt sich Hirsts Plan in den größeren Kontext der zeitgenössischen Debatten rund um Digitalität, NFT-Kunst und virtuelle Ausstellungen ein. In einer Zeit, in der Kunst immer mehr immateriell und vernetzt wird, öffnet seine Idee ein spannendes Kapitel, in dem Kunst nicht nur über räumliche, sondern auch über zeitliche Grenzen hinaus Bestand haben kann. Schließlich ist Damien Hirsts Vorhaben auch eine sehr persönliche Reflexion über das Leben, die Kunst und die Zukunft.
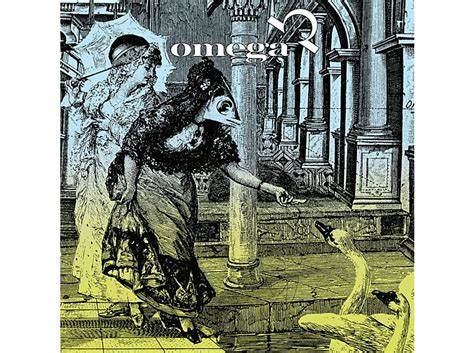





![Opening the Doors of Creativity [video] (1990)](/images/77411B4D-DD1C-4184-9CB7-7C8BC7DBA530)


