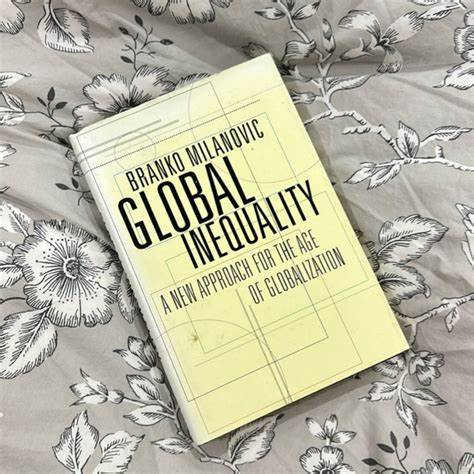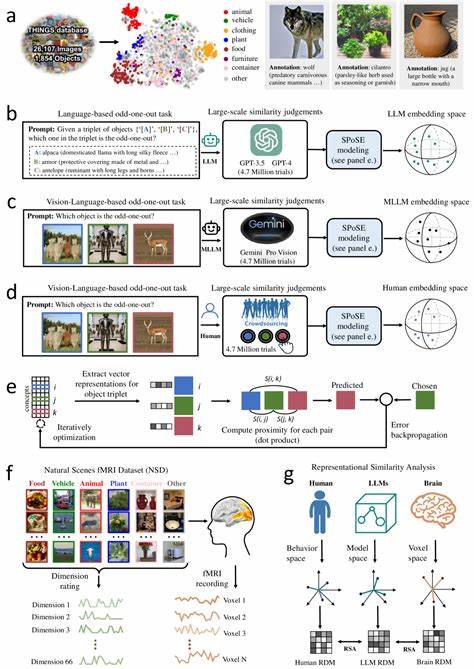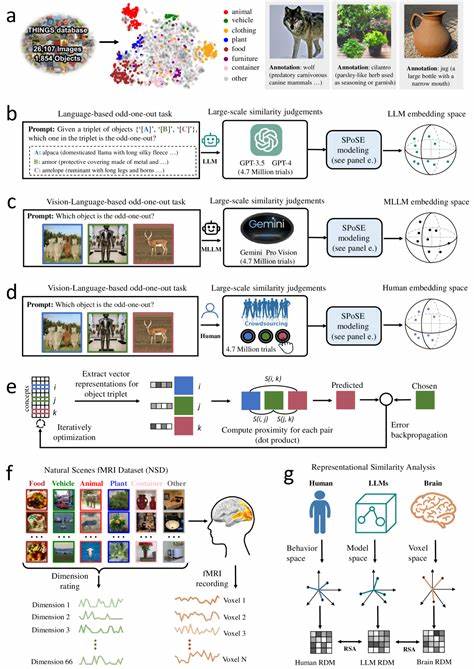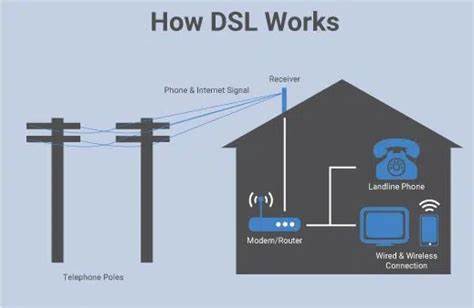Globale Ungleichheit ist eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Während innenpolitische Debatten oft den Fokus auf nationale Unterschiede bei Einkommen und Vermögen legen, eröffnet der serbisch-amerikanische Ökonom Branko Milanovic eine umfassendere Perspektive, die Menschen über Ländergrenzen hinweg betrachtet. Seine Arbeit hat die Art und Weise, wie wir Ungleichheit verstehen, grundlegend verändert und betont die Bedeutung einer globalen Sichtweise. Milanovic definiert globale Ungleichheit im Kern als die Ungleichheit zwischen Menschen weltweit. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von den häufigeren Analysen, die sich nur auf einzelne Länder oder Regionen konzentrieren.
Stattdessen betrachtet er die Einkommensverteilung über die gesamte Weltbevölkerung hinweg – von den ärmsten Gemeinden Afrikas bis zu den wohlhabendsten Stadtteilen Europas, Nordamerikas oder Asiens. Die technische Herausforderung bei der Analyse globaler Ungleichheit besteht vor allem in der Datenbeschaffung, da es keine weltweite Haushaltseinkommensbefragung gibt. Milanovic erklärt, dass zur Erstellung eines globalen Einkommensverteilungsbildes verschiedene nationale Daten harmonisiert werden müssen. Dazu zählt die Umrechnung aller Einkommen in sogenannte Kaufkraftparitäten (PPP), damit die Unterschiede der Lebenshaltungskosten weltweit angemessen berücksichtigt werden. Die Beschränkung der Datenverfügbarkeit, besonders in Regionen wie Afrika, erschwert das Auswerten umfassender und repräsentativer globaler Analysen.
Eine seiner bekanntesten Forschungsbeiträge ist die sogenannte „Elefanten-Kurve“, die erstmals in den 2010er Jahren große Aufmerksamkeit erlangte. Sie zeigt die Einkommensgewinne verschiedener Teile der globalen Bevölkerung während der Hyper-Globalisierungsphase von etwa 1988 bis 2008. Die Kurve weist eine charakteristische Form auf, die an einen Elefanten erinnert: Ein dekadenter Anstieg bei den ärmeren Bevölkerungen der Schwellenländer, insbesondere in China und Indien, zeigt massive Fortschritte der Mittelschicht in diesen Staaten. Gleichzeitig profitieren die globalen Topverdiener, vor allem die vermögenden Eliten in den USA und Europa, erheblich von der wirtschaftlichen Entwicklung. Zwischen diesen Gruppen befindet sich die abgehängte Mittelschicht der westlichen Industrieländer, die vergleichsweise geringe Einkommenszuwächse verzeichnete.
Diese Erkenntnis war für viele Beobachter wegweisend, da sie den komplexen Einfluss der Globalisierung auf verschiedene soziale Gruppen nachvollziehbar machte. Interessant ist, dass Milanovic den Zeitraum nach 2008 als eine Phase beschreibt, in der sich diese Trends nicht wie zuvor fortsetzen. Die rasante Einkommenssteigerung für die globale Oberschicht hat sich verlangsamt. Faktoren wie die Finanzkrise 2008, geopolitische Spannungen und Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur beeinflussen die weitere Entwicklung der globalen Einkommensverteilung. Gleichzeitig bleiben große Herausforderungen bestehen, etwa die wachsende Ungleichheit innerhalb einzelner Länder und Regionen.
Milanovic macht deutlich, dass der Ort der Geburt und die Herkunftsfamilie die entscheidenden Einflussgrößen für das individuelle Einkommensniveau darstellen. Seine empirischen Analysen zeigen, dass etwa 80 bis 90 Prozent der Unterschiede im weltweiten Einkommen durch diese beiden Faktoren erklärbar sind. Somit beeinflusst das Land, in dem man geboren wird, weitaus stärker das wirtschaftliche Schicksal als individuelle Anstrengungen oder gar Talent. Diese Erkenntnis stellt viele westliche Vorstellungen von sozialer Mobilität und Gerechtigkeit infrage und regt zu einem Nachdenken über globale Gerechtigkeitsprinzipien an. Interessanterweise verweist Milanovic auf die politische Philosophie als wichtigen Bereich, der Fragen globaler Ungleichheit aufwirft.
So diskutieren Philosophen wie John Rawls nicht nur über Gerechtigkeit innerhalb von Nationalstaaten, sondern auch darüber, welche Verteilungsprinzipien auf der Ebene der gesamten Menschheit gelten sollten. Rawls’ Konzept des „Schleiers des Nichtwissens“ wird dabei erweitert: Gilt es nur national oder global? Milanovic erläutert, dass philosophische Debatten bisher oft den Mangel an empirischen Daten bedingten und dass seine Forschungen diese Lücke inzwischen schließen helfen. Ein Beispiel ist die kontroverse Frage der Migrationspolitik, bei der Rawls eine restriktive Haltung vertritt, während Milanovic die Debatte als Teil eines größeren Verständnisses globaler Ungleichheit sieht. Darüber hinaus reflektiert Milanovic historische Gedanken zur Ungleichheit und stellt die Sichtweisen klassischer Ökonomen wie Adam Smith, David Ricardo oder Karl Marx vor. Ihm zufolge wurde Adam Smith häufig falsch interpretiert, insbesondere von heutigen Wirtschaftsextremen, die seinen Namen für eine unkritische Verherrlichung des Kapitalismus benutzen.
Tatsächlich war Smith sehr kritisch gegenüber Kapitalisten und sozialen Ungleichheiten und sah die Interessen der Kapitalbesitzer oft im Widerspruch zum Gemeinwohl. Diese historischen Perspektiven dienen Milanovic dazu, die heutige Diskussion über Ungleichheit mit einem tieferen Verständnis der zugrunde liegenden ökonomischen Theorien zu bereichern. Ein weiterer spannender Aspekt seiner Arbeit betrifft den Wandel der ökonomischen Forschung. Während in der klassischen Ökonomie Einkommensverteilung und Klassenstrukturen eine zentrale Rolle spielten, verschwand das Thema innerhalb der Wirtschaftswissenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend aus dem Fokus. Gründe hierfür sah Milanovic in der politischen Dynamik während des Kalten Krieges, der Konkurrenz zum kommunistischen Modell und in der Entwicklung neuer ökonomischer Theorien, die auf abstrakten Gleichgewichtsmodellen basieren und keine Klassenanalysen mehr hervorheben.
Diese Abkehr führte zu einer fehlenden Aufmerksamkeit für wachsende Ungleichheiten in vielen westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten. Milanovic stellt auch fest, dass politische Faktoren maßgeblich beeinflussen, welche ökonomischen Fragen Aufmerksamkeit erhalten. So werde das Thema Ungleichheit zeitweise marginalisiert, da es einerseits politisch brisant ist und andererseits schwer in traditionelle Wirtschaftstheorien integrierbar erscheint. Sein Engagement für die Vermessung und Analyse globaler Einkommensverteilung trägt dazu bei, Ungleichheit wieder ins Zentrum wirtschaftspolitischer Debatten zu rücken. Die Erkenntnisse von Milanovic sind nicht nur für Wissenschaftler interessant, sondern auch für politische Entscheidungsträger, Aktivisten und die breite Öffentlichkeit.
Sie zwingen uns dazu, globale Ungleichheit nicht mehr nur als abstraktes Problem zu sehen, sondern als eine lebendige Realität, die das Leben von Milliarden Menschen prägt und zu politischen Spannungen und sozialen Herausforderungen weltweit führt. Besonders die Feststellung, dass Herkunft und Geburtsort eine determinierende Rolle spielen, wirft moralische und ethische Fragen auf. Wie sollte die internationale Gemeinschaft mit diesen Ungleichheiten umgehen? Welche Verantwortung tragen wohlhabende Länder gegenüber ärmeren Gesellschaften? Inwieweit können Maßnahmen wie faire Handelsbedingungen, Entwicklungszusammenarbeit oder eine Reform des globalen Wirtschaftssystems zur Verringerung der Ungleichheit beitragen? Die globale Perspektive von Milanovic erweitert unseren Blick und fordert traditionelle nationale Denkweisen heraus. Statt lediglich die Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft zu betrachten, schärft seine Analyse das Bewusstsein für die weltweiten Verknüpfungen zwischen Ökonomien, Gesellschaften und individuellen Lebensschicksalen. Damit bietet seine Arbeit eine Grundlage für eine gerechtere und inklusivere Gestaltung der globalen Wirtschaftsordnung.
Abschließend lässt sich sagen, dass Branko Milanovics Forschung zur globalen Ungleichheit eine entscheidende Rolle dabei spielt, die komplexen Dynamiken der heutigen Welt besser zu verstehen. Seine Datenanalysen, Konzepte wie die Elefanten-Kurve und die kritische Auseinandersetzung mit wirtschaftshistorischen und philosophischen Ansätzen machen deutlich, wie全球化和收入差距相互作用,如何塑造了各国人民的生活前景。他的工作为构建更公平的全球社会提供了理论支持和实证基础,同时也敦促我们重新思考经济正义的全球内涵。在当代全球化不断演进的背景下,理解并应对全球不平等是实现和平与繁荣不可回避的任务。.