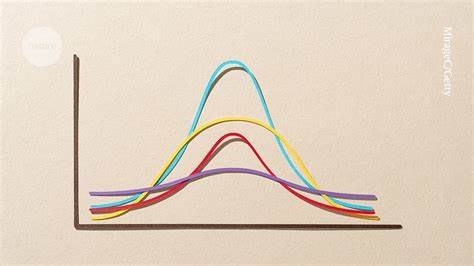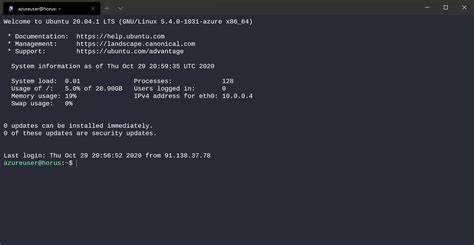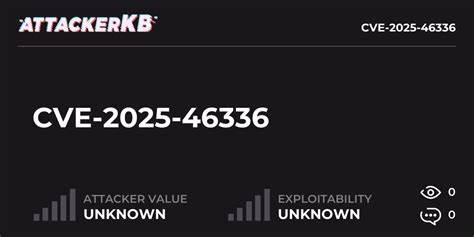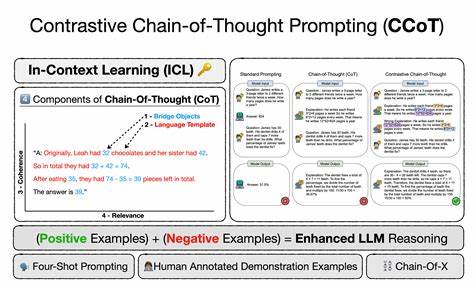Die Sehgewohnheiten haben sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Streamingdienste bieten eine Fülle an Inhalten, die oft mit modernster Technik aufbereitet werden, um Zuschauer auf großen, hochauflösenden Bildschirmen bestmöglich zu bedienen. Doch gerade bei alten Fernsehklassikern aus den 80er und 90er Jahren wirkt die digitale Aufwertung mit künstlicher Intelligenz häufig kontraproduktiv. Zu den prominentesten Beispielen zählen die beliebten Sitcoms ‚Roseanne‘ und ‚A Different World‘, deren KI-basiertes Upscaling von Fans und Kritikern gleichermaßen als Grusel-Erlebnis empfunden wird. Was einst nostalgischen Charme und warme Erinnerungen weckte, erscheint heutzutage in verwaschenen, verzerrten und teilweise sogar unangenehm wirkenden Bildern, die eher an Albträume erinnern als an geliebte TV-Klassiker.
Die hinter diesen Veränderungen stehenden Ursachen, die beteiligten Akteure und die möglichen Konsequenzen für die Zukunft der Fernseharchivierung verdienen eine differenzierte Betrachtung. ‚Roseanne‘ und ‚A Different World‘ sind emblematische Serien, die Jahrzehnte nach ihrer ursprünglichen Ausstrahlung auf modernen Plattformen wie Peacock und Netflix abrufbar sind – allerdings in neu aufbereiteten Fassungen. Die Neuauflagen sollen eigentlich der Sehqualität dienen, indem sie die alten Standard Definition Aufnahmen in 4K-Auflösung hochskalieren und an das heutige technische Umfeld anpassen. Doch die Realität sieht anders aus: Gesichter wirken verzerrt, Augen scheinen sich unnatürlich zu bewegen und Detailbereiche, insbesondere mit Texten im Bild, werden unlesbar und zu grotesken, kaum wiedererkennbaren Formen. Die Bildqualität gleicht eher einem surrealen Alptraum als einer verbesserten Version des Originals.
Derartige visuelle Artefakte rufen Unmut bei Fans hervor, die sich eine behutsamere Aufbereitung gewünscht hätten. Die Schuld wird häufig zunächst auf die Streaminganbieter wie Netflix oder Peacock geschoben, die die Inhalte bereitstellen. Doch in Wahrheit sind es in vielen Fällen die Produktionsfirmen und Rechteinhaber, die den Auftrag zur digitalen Remasteringarbeit geben. Im Falle von ‚Roseanne‘ und ‚A Different World‘ zeichnet sich insbesondere die Carsey-Werner Company als verantwortliche Produktionsgesellschaft ab. Carsey-Werner verwaltet die Rechte an zahlreichen Kultklassikern und vergibt Lizenzen an verschiedene Streaming-Plattformen.
Das Unternehmen hat die Aufgabe der Auffrischung dieser älteren Serien an spezialisierte Dienstleister vergeben, die mit Hilfe von KI-Technologien die Bildqualität angeblich verbessern sollen. Allerdings scheint das Hauptaugenmerk weniger auf einer sorgfältigen und liebevollen Restaurierung zu liegen, sondern vielmehr auf kosteneffizienter Massenproduktion und schneller Verfügbarkeit auf dem Markt. Die Transformation von Videos aus dem ursprünglichen 4:3-Format mit niedriger Auflösung in moderne 16:9-Videoformate mit 4K-Auflösung ist eine technische Herausforderung, die enorme Komplexität und gewissenhafte Arbeit erfordert. Für hochpreisige, sorgfältig restaurierte Serien wie ‚The X-Files‘ oder ‚Star Trek: The Next Generation‘ wurden jahrelang Originalfilm-Materialien gesichtet, digital aufwendig nachbearbeitet und mit Fingerspitzengefühl neue Bildausschnitte geschaffen, sodass die Serien auch auf modernen Bildschirmen brillieren. Diese Arbeit ist jedoch kostenintensiv: Für ‚Star Trek‘-Folgen beliefen sich die Produktionskosten auf bis zu 70.
000 US-Dollar pro Episode. Solche Investitionen stehen aber bei älteren Sitcoms, deren Rechte häufiger den Besitzer wechseln und deren Streaming-Exklusivität zeitlich begrenzt ist, meist nicht zur Verfügung. Daher wird zunehmend auf automatisierte KI-Upscaling-Verfahren zurückgegriffen, die zwar schnell und preiswert sind, aber aufgrund der Unzulänglichkeiten moderner Algorithmen häufig deutliche Qualitätsmängel und visuelle Störungen produzieren. Das Ergebnis ist einerseits enttäuschend für langjährige Fans und Sammler, die sich den Erhalt möglichst nah am Original wünschen, und andererseits widerspricht es auch dem ästhetischen Anspruch der Serienmacher. Die feinen Nuancen der Schauspielgesichter, die atmosphärische Körnung des Filmmaterials und selbst die Beschriftungen in Szenen – etwa die Menüs in der fiktiven „Lanford Lunch Box“ aus ‚Roseanne‘ – werden verfälscht, unleserlich oder gar grotesk verändert.
Dies führt zu einem Bruch in der visuellen Identität der Serien und lässt sie auf heutigen Bildschirmen oft unnatürlich und befremdlich erscheinen. Besonders auffällig sind die „schwimmenden“ Augen, verschwommene Gesichtszüge sowie das chaotische, verwackelnde Bildrauschen als Folge der KI-Verarbeitung. Die mangelnde Transparenz und Kommunikation von Carsey-Werner und den Dienstleistern verschärfen die Problematik. Während in Pressemitteilungen von „fortschrittlichen KI-Technologien“, „fachkräftiger künstlerischer Mitarbeit“ und „Ehrung des Originalmaterials“ gesprochen wird, bleiben genaue Details zum verwendeten Verfahren und den Qualitätskontrollen aus. Zudem reagierte das Unternehmen auf Anfragen nicht und überließ somit Fans und Kritikern die Deutung der misslungenen Resultate.
Selbst die Werbevideos für die Remaster konnten die unnatürlichen Artefakte nicht verbergen und verstärken den Eindruck, dass es sich hier eher um einen Schnellschuss denn um eine liebevolle Aufarbeitung handelt. Die verzweifelte Situation zeigt sich auch an der zunehmenden Fragmentierung des Streamingmarktes. Serien wechseln regelmäßig zwischen Plattformen wie Netflix, Peacock, Amazon Prime oder anderen, was den Einsatz aufwändiger Restaurierungsprozesse wirtschaftlich unattraktiv macht. Rechteinhaber wollen oftmals nur die Texturen schnell und billig aufpeppen, ohne langfristige Verantwortung für die mediale Bewahrung zu übernehmen. Die Folge ist, dass ältere Serien immer schlechter präsentiert werden, obwohl sie kulturell weiterhin eine große Relevanz besitzen und neue Zuschauer anziehen könnten.
Der Ärger der Zuschauer spiegelt sich auch in sozialen Netzwerken wider. Prominente Persönlichkeiten wie Scott Hanselman haben auf Plattformen wie TikTok die Fehler sichtbar gemacht und damit eine breitere Diskussion angestoßen. Nutzer beschreiben das Ergebnis als „Halluzinationen“ durch KI, die keinesfalls für Nostalgiefans geeignet sind. Die emotionale Verbindung zur Serie wird durch die unnatürlichen Veränderungen verletzt. Unter dem Strich drängt sich die Frage auf, ob es nicht bessere Alternativen gibt.
Eine häufig gegebene Empfehlung ist, als Zuschauer selbst aktiv zu werden: Physische Medien wie DVDs oder Blu-Rays bieten oftmals noch deutlich bessere Qualität und Authentizität als manche Streamingfassung. Auch digitale Ankäufe von Originalfassungen können eine Überlegung wert sein. Gleichzeitig bleiben technische Leihbibliotheken, Filmarchive und nicht kommerzielle Restaurationsinitiativen wichtige Stützpfeiler im Erhalt von Fernseherbe. Langfristig tragen sie dazu bei, dass Kulturgüter nicht in billigen AI-Fehlinterpretationen verloren gehen. Es ist auch zu hoffen, dass sich die Technologie weiterentwickelt und künftig Algorithmen verfügbar werden, die eine ungefährliche und ästhetisch anspruchsvolle Aufbereitung erlauben.
Das erfordert jedoch Zeit, Geld und vor allem eine Wertschätzung gegenüber dem ursprünglichen Material und seinen Besonderheiten. Ein rein ökonomisch getriebenes Vorgehen mit Fokus auf Kostenreduktion und schneller Veröffentlichung zieht langfristig den Kürzeren, denn die Sehqualität und das Zuschauererlebnis leiden darunter erheblich. Die KI-basierte Aufbereitung von Fernsehklassikern eröffnet zweifelsfrei neue Möglichkeiten. Sie macht es potenziell leichter, jahrzehntealte Inhalte auf modernen Geräten zugänglich zu machen. Doch ohne sorgsame Umsetzung kann sie schnell zum Fluch werden – wie die Fälle ‚Roseanne‘ und ‚A Different World‘ eindrucksvoll illustrieren.
Zuschauer und Fachwelt fordern daher mehr Transparenz, Standards und nachhaltige Restaurationskonzepte, die Bewahrung und Modernisierung in Einklang bringen. Der mediale und kulturelle Wert der alten Sitcoms und Serien sollte nicht nur als Zahl in einer Lizenzvereinbarung gesehen werden. Sie sind Teil des kollektiven Gedächtnisses und verdienen eine Behandlung, die ihren Charme und ihre Qualität bewahrt. Denn was bringt die modernste Auflösung, wenn das Wesentliche verloren geht und die Zuschauer das Gefühl bekommen, Bekannte in verzerrten Albtraumbildern zu sehen? Die Zukunft der klassischen TV-Inhalte hängt daher davon ab, wie sorgfältig, respektvoll und transparent wir mit der digitalen Bewahrung umgehen – und ob wir als Gesellschaft bereit sind, auch die nötigen Ressourcen dafür bereitzustellen.