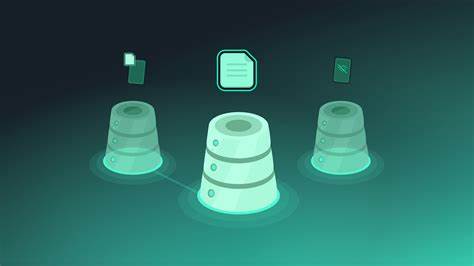Die Ozeane sind ein komplexes System, in dem eine Vielzahl chemischer, physikalischer und biologischer Prozesse miteinander verflochten sind. Insbesondere die Zirkelkreisläufe von Spurenelementen spielen eine entscheidende Rolle für das Funktionieren mariner Ökosysteme und haben darüber hinaus bedeutende Auswirkungen auf globale biogeochemische Prozesse und den Klimawandel. Lange Zeit standen dabei die oberen Wasserschichten im Fokus der Forschung, während der abyssose Meeresboden, also die tiefsten Regionen der Ozeane, weitgehend als inaktiv eingestuft wurde. Neuere Studien und innovative Modellierungen zeigen jedoch, dass dieser abysale Bereich eine zentrale Rolle bei der Steuerung der biogeochemischen Zyklen von Spurenelementen einnimmt, was die Wahrnehmung des tiefen Ozeans grundlegend verändert. Das Verständnis der Spurenelemente im Ozean beruht auf zwei unterschiedlichen, historischen Konzepten.
Das traditionelle Modell betrachtet vor allem die reversible Anlagerung von Spurenelementen an Teilchen in der oberen Wassersäule und ihre anschließende Freisetzung im Zuge der Partikelzersetzung. Demgegenüber steht das Konzept des sogenannten Grenzflächenaustauschs, bei dem der Austausch an den Kontaktflächen zwischen Wassersäule und Sedimenten, insbesondere am Meeresboden, eine dominante Rolle einnimmt. Die alten Modelle setzen auf eine vorwiegend wasserbasierte Kontrolle des Spurenelementkreislaufs, während das neuere Grenzflächenkonzept insbesondere die Bedeutung sedimentärer Quellen und Prozesse betont. In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass die oft vernachlässigten authigenen Minerale – das sind Minerale, die direkt im Meerwasser oder in den Sedimenten entstehen, wie beispielsweise Mangan- und Eisenoxide – eine besondere Rolle bei der Aufnahme und Freisetzung von Spurenelementen spielen. Besonders Manganoxide haben eine sehr starke Affinität zu bestimmten Spurenelementen wie den Seltenen Erden und Neodym, die als Modelltracer für biogeochemische Kreisläufe dienen.
Diese Minerale wirken als effiziente „Fänger“ für Spurenelemente und beeinflussen deren Verteilung und Transport im Ozean. Die chemischen Prozesse, welche die Freisetzung und Aufnahme von Spurenelementen am abysalen Meeresboden steuern, sind eng mit der sogenannten oxischen Diagenese verbunden. Unter diesen rein oxidativen Bedingungen wird organisches Material im Sediment abgebaut, was den pH-Wert senkt und die Lösung von Metallen und deren Austausch zwischen Feststoffen und porewassergefüllten Porenräumen im Sediment fördert. Diese Prozesse führen dazu, dass Spurenelemente aus den Sedimenten in das darüberliegende Wasser diffundieren, was als benthischer Fluss bezeichnet wird. Obwohl dieser Fluss im Verhältnis zum Partikelfluss klein erscheint, ist er aufgrund der großen Fläche des abysalen Ozeanbodens – sie macht den weitaus größten Teil der Meeresbodenzone aus – ein äußerst bedeutender Beitrag zur Spurenelementverteilung.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die physikalische Dynamik des abysalen Ozeans mit seiner starken vertikalen Durchmischung. Durch Wechselwirkungen zwischen internen Gezeitenwellen und der Topografie des Meeresbodens entsteht intensive turbulente Mischungen, die insbesondere in tiefen Wasserschichten stark ausgeprägt sind. Diese vertikale Durchmischung führt dazu, dass die aus den Sedimenten austretenden Spurenelemente effektiv in die Wassersäule transportiert und großräumig verteilt werden können, was die Auswirkungen des benthischen Flusses auf die biogeochemischen Zyklen verstärkt. Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse werden deutlich, wenn man sich die Verteilung von Neodymkonzentrationen und dessen Isotopensignaturen im Pazifik anschaut. Die konventionellen Modelle mit Fokus auf oberflächennahe Quellen und reversible Partikelsorption können die beobachteten Konzentrationsprofile nicht vollständig erklären, insbesondere die nahezu lineare Zunahme der Neodymkonzentration mit der Tiefe.
Ein Modell, das den benthischen Fluss als wichtige Quelle einschließt und die Affinität von Neodym zu Manganoxiden berücksichtigt, kann diese Verteilung hingegen realistisch reproduzieren. Darüber hinaus lässt sich das gemessene Isotopenmuster von Neodym im tiefen Pazifik besser deuten, wenn neben dem wiederaufbereiteten, „recycelten“ Neodym aus der Wassersäule auch eine „neue“ Quelle aus der Verwitterung mariner Silikate im Sediment mit berücksichtigt wird. Diese „neue“ Quelle besitzt eine andere Isotopensignatur als die Oberflächenwässer und beeinflusst so entscheidend die Isotopenverteilung im Tiefwasser. Die Kombination aus biologischen, chemischen und physikalischen Mechanismen legt nahe, dass sich die biogeochemischen Kreisläufe von Spurenelementen im Ozean als ein integriertes System verstehen lassen, bei dem sowohl „top-down“-Prozesse wie Partikelproduktion und -remineralisierung in der Oberflächenzone als auch „bottom-up“-Prozesse am Meeresboden eine entscheidende Rolle spielen. Besonders die Art der Teilchen – ob biogen oder authigen – bestimmt maßgeblich die Bindung und Verteilung der Spurenelemente.
Diese neuen Erkenntnisse stellen die Rolle des abysalen Meeresbodens als eine aktive biogeochemische Schaltstelle heraus. Der Meeresboden fungiert als Quelle und Senke zugleich, die darüber hinaus auch das isotopische Signal von Spurenelementen maßgeblich prägt. Dies hat weitreichende Folgen für die Nutzung von Spurenelementen und deren Isotopen als Tracer zur Rekonstruktion vergangener ozeanischer Zirkulationsmuster und klimatischer Veränderungen. Neben Neodym und den Seltenen Erden erhalten auch andere wichtige Spurenelemente wie Eisen, Kupfer, Nickel und Chrom durch die Rolle der authigenen Minerale und benthischen Prozesse eine neue Einordnung in ihren marinen Kreisläufen. Beispielsweise weist Kupfer mit einer hohen Affinität zu Manganoxiden im Ozean ähnliche Muster wie Neodym auf und wird durch benthische Quellen wesentlich beeinflusst.
Ein weiterer bedeutender Aspekt dieser Forschung ist die Betonung der geografischen und topographischen Gegebenheiten des Meeresbodens. Die Verteilung und Struktur der ozeanischen Becken und Kämme beeinflussen die Synthese von turbulenten Mischungen und somit die Verteilung und Wirkung der benthischen Spurenelementflüsse. Im Wandel der Erdgeschichte, mit Verschiebungen in der Meeresbodentopographie, könnten dadurch langfristige Veränderungen in biogeochemischen Kreisläufen ausgelöst worden sein. Auch der Einfluss von hydrothermalen Quellen als bedeutende Lieferanten von Mangan und anderen Metallen an den Meeresboden gewinnt an Bedeutung. Diese Quellen tragen dazu bei, dass authigene Manganoxide gebildet werden, welche wiederum als starke Adsorbenten für Spurenelemente fungieren.
Die Wechselwirkung zwischen hydrothermalen Prozessen und den benthischen Kreisläufen ist somit ein weiterer wichtiger Hebel für die globale Spurenelementdynamik. Darüber hinaus lässt sich diskutieren, welche Rolle mariner Silikatverwitterung im Sediment für den globalen Kohlenstoffkreislauf spielt. Da diese Verwitterungsprozesse Kohlendioxid aufnehmen, könnten sie einen wichtigen Beitrag zur globalen Klimaregulation leisten – neben der bislang hauptsächlich betrachteten kontinentale Silikatverwitterung. Die aktuelle Forschung unterstreicht somit, dass die abyssale Ozeanzone keineswegs ein statisches, inaktives Reservoir darstellt, sondern eine dynamische biogeochemische Arena, die entscheidend zur Verteilung und Veränderung von Spurenelementen und deren Isotopensignaturen beiträgt. Um marine Ökosysteme umfassend zu schützen und klimarelevante Prozesse besser zu verstehen, muss die wissenschaftliche Betrachtung des Ozeans folglich stärker integriert und die Bedeutung der Tiefsee umfassender anerkannt werden.