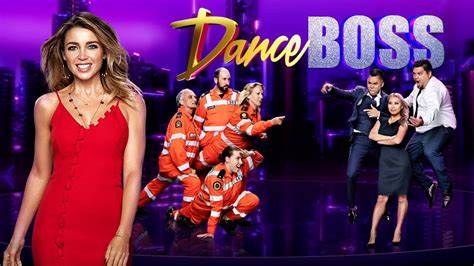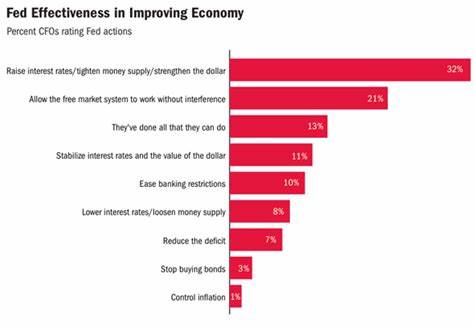Im Juni 2021 erlebte Seattle eine beispiellose Hitzewelle, bei der die Temperaturen auf über 42 Grad Celsius kletterten – ein Rekordwert für die US-Küstenstadt. An jenem Tag wurde Juliana Leon, eine 65-jährige Frau aus der Stadt, bewusstlos in ihrem Auto aufgefunden und starb wenig später an den Folgen einer Hyperthermie, einer gefährlichen Überhitzung des Körpers. Ihr Tod wird nun zum Mittelpunkt eines historischen Rechtsstreits, da ihre Tochter Misti Leon sieben der weltweit größten Öl- und Gasunternehmen – darunter BP, Shell, Exxon Mobil und Chevron – wegen fahrlässiger Tötung verklagt. Der Fall markiert den ersten Versuch in den USA, Konzerne direkt für Todesfälle zu belangen, die durch durch den Klimawandel bedingte Wetterextreme verursacht wurden. Dieses Verfahren könnte eine grundlegende Wende in der Klimaklagen-Geschichte darstellen und eröffnet eine neue juristische Dimension, die Auswirkungen auf globale Konzerne und zukünftige Prozesse haben könnte.
Im Kern beruht die Klage auf der Annahme, dass diese Unternehmen über Jahrzehnte hinweg wissentlich fossile Brennstoffe produziert und beworben haben, wohl wissend, dass ihre Produkte eine Erwärmung der Erdatmosphäre verursachen. Das Verfahren wirft den Konzernen vor, eine "fossilbasierte Wirtschaft" gefördert zu haben, deren Folgen in vermehrten und intensiveren Naturkatastrophen sowie vorhersehbaren Todesfällen liegen. Die Klägerin strebt nicht nur Schadensersatz an, sondern fordert auch, dass die Ölkonzerne eine öffentliche Aufklärungskampagne unterstützen sollen, um jahrzehntelange Fehlinformationen über den Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen und der Erderwärmung auszuräumen. Eine der Herausforderungen der Klage besteht darin, die Verantwortung der einzelnen Unternehmen für die spezifischen Emissionen zu belegen, die zur tödlichen Hitzewelle beitrugen. Die sogenannte „Attributionswissenschaft“ spielt dabei eine zentrale Rolle und nutzt fortschrittliche Forschungsmethoden, um zu schätzen, inwieweit der menschengemachte Klimawandel Extremwetterereignisse wahrscheinlicher oder intensiver gemacht hat.
Analysen der Hitzewelle an der US-Westküste ergaben, dass ein solcher Temperaturanstieg ohne den Einfluss des Klimawandels praktisch unmöglich gewesen wäre. Ohne den Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen wäre ein solches Ereignis etwa 150-mal seltener aufgetreten, und während diese Hitzewelle heute einem tausendjährigen Ereignis gleicht, könnte sie bei weiterem Temperaturanstieg bereits alle fünf bis zehn Jahre vorkommen. Der rechtliche Ansatz der Klägerin basiert auf dem sogenannten Deliktsrecht, wonach Einzelpersonen Anspruch auf Entschädigungen für von Dritten verursachte Schäden haben. Dieser Weg unterscheidet sich von bisherigen Klimaklagen, die sich meist auf staatliche Emissionsvorschriften oder internationale Abkommen stützten. Die Anwendung des Deliktsrechts auf den Klimawandel ist aufgrund der komplexen Verknüpfung zwischen globalen Emissionen und lokalen Wetterereignissen bisher selten, birgt aber das Potenzial, Unternehmen direkt für die Schäden zur Rechenschaft zu ziehen, die aus ihren Geschäftsaktivitäten resultieren.
Diese Klage hat Parallelen zu früheren Fällen, bei denen Einzelpersonen Unternehmen für gesundheitliche Schäden verantwortlich machten, wie etwa bei Zigaretten oder Asbest. Dort konnten Kläger erfolgreich Schadensersatz für Krankheiten erwirken, die durch Produkte oder Arbeitsbedingungen verursacht wurden. Im Klimabereich gibt es bereits Verfahren gegen Ölkonzerne wegen angeblicher Täuschung oder unterlassener Vorsorge, meist jedoch von staatlichen Institutionen. Der Seattle-Fall ist nun der erste, der eine individuelle Klage wegen Todes durch Klimafolgen darstellt und damit einen möglichen Präzedenzfall schafft. Auch auf internationaler Ebene gab es ähnliche Bemühungen.
Im sogenannten Urgenda-Fall in den Niederlanden erzwang ein Gericht von der Regierung stärkere Klimaschutzmaßnahmen, angesichts der Verletzung einer Fürsorgepflicht gegenüber Bürgern. In Deutschland versuchte ein peruanischer Landwirt, den Energiekonzern RWE für die Überschwemmungsrisiken zu belangen, die durch den Klimawandel verstärkt wurden. Zwar scheiterte der Fall an der Beweisführung, doch der Gerichtshof erkannte prinzipiell die Möglichkeit der Haftung eines Energieunternehmens für klimabedingte Schäden an. Diese Entwicklung zeigt, dass nationalstaatliche Gerichte zunehmend bereit sind, Verantwortung von Unternehmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu prüfen. Die Öl- und Gasindustrie weist die Vorwürfe jedoch vehement zurück.
Chevron bezeichnete die Klage als politisch motiviert und wissenschaftlich unbegründet. Unternehmenssprecher kritisierten, dass der Fall eine persönliche Tragödie ausnutze, um politische Forderungen durchzusetzen, und erwarten, dass das Gericht die Klage abweist, wie zahlreiche frühere Fälle dieser Art. Dennoch steht fest, dass die Bedrohung durch den Klimawandel immer stärker in den Fokus der Justiz rückt und Unternehmen sich zunehmend mit juristischen Konsequenzen ihres Handelns auseinandersetzen müssen. Wissenschaftler und Rechtsexperten betonen die Bedeutung der Attributionstechnologie bei solchen Rechtsfällen, um einen kausalen Zusammenhang zwischen den Emissionen der Unternehmen und dem Extremwetter herzustellen. Die Herausforderung liegt darin, den Beitrag der einzelnen Unternehmen an den globalen Emissionen festzumachen.
Zwar lässt sich mittlerweile ziemlich genau bestimmen, in welchem Ausmaß menschliche Aktivitäten die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Extremereignissen erhöhen, jedoch ist die Aufteilung der Verantwortung auf einzelne Akteure komplex. Im Gegensatz zu vielen staatlichen Klagen, die meist auf Regulierungen oder Umweltgesetzen beruhen, eröffnet der Weg über das Deliktsrecht für Parallelschäden eine neue Möglichkeit, Gerechtigkeit für einzelne Opfer zu schaffen. Sollte dieser Fall vor Gericht Erfolg haben, könnten Einzelpersonen und Gemeinschaften weltweit Schadensersatz fordern für klimabedingte Verletzungen und Todesfälle. Damit würde sich die rechtliche Landschaft grundlegend verändern, Unternehmen würden sich stärker mit den direkten Folgen ihres Handelns konfrontiert sehen. Die Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss könnte eine Welle ähnlicher Klagen auslösen und die Ölindustrie finanziell wie reputativ erheblich unter Druck setzen.
Es könnten sogar weitergehende juristische Konzepte wie „Klimamord“ oder „wirtschaftliche Fahrlässigkeit“ diskutiert werden, die über zivilrechtliche Schadensersatzansprüche hinausgehen. Damit wäre eine neue Ära eingeleitet, in der fossile Konzerne nicht nur durch politische oder gesellschaftliche Sanktionen, sondern auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten. Parallel verändern sich öffentliche Wahrnehmung und gesellschaftlicher Druck auf Unternehmen rapide. Das Bewusstsein über die Folgen des Klimawandels steigt, und die Forderungen nach Verantwortlichkeit werden lauter. Die Verbindung von Gesundheitsschäden und Umweltfolgen sorgt für eine neue Dringlichkeit und Empathie in der Bevölkerung.
Klimaklagen werden zunehmend auch als Mittel der sozialen Gerechtigkeit gesehen, um den Opfern eine Stimme zu geben, die vom Klimawandel überproportional betroffen sind. Der Fall von Juliana und Misti Leon steht stellvertretend für Millionen von Menschen weltweit, die schon heute unter den fatalen Folgen der Erderwärmung leiden. Hitze gilt als „stiller Killer“ und hat allein zwischen 2000 und 2019 fast eine halbe Million Todesfälle jährlich verursacht. Ereignisse wie die Hitzewelle im pazifischen Nordwesten, von der Millionen betroffen waren, illustrieren die dramatische Realität des Klimawandels. Abschließend lässt sich sagen, dass der erste Klima-Todesfall-Prozess gegen große Ölkonzerne nicht nur ein juristisches Novum darstellt, sondern auch ein Symbol für die wachsende Forderung nach Klimagerechtigkeit.
Er stellt die Weichen dafür, wie Gesellschaft, Rechtsprechung und Wirtschaft künftig mit den komplexen Herausforderungen des Klimawandels umgehen werden. Ob der Prozess erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten, doch die Möglichkeiten für weitere Klagen gegen Verursacher steigen kontinuierlich. In jedem Fall ist dieser Rechtsstreit ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Transparenz, Verantwortung und letztlich einer besseren Zukunft für kommende Generationen.