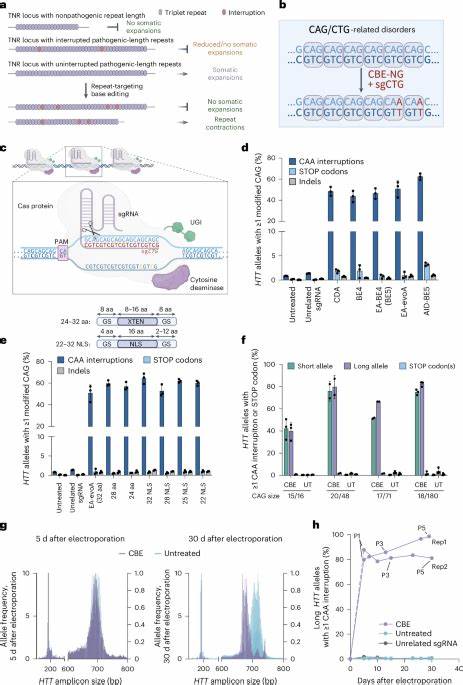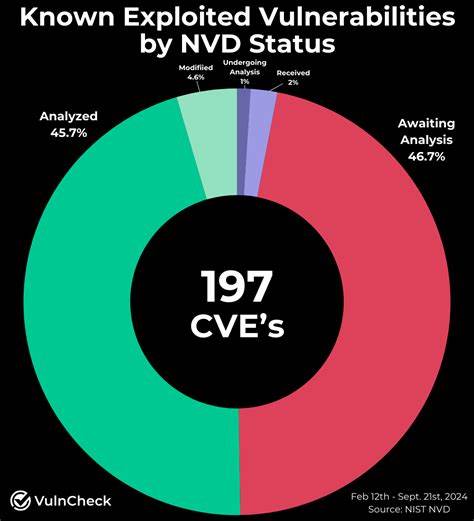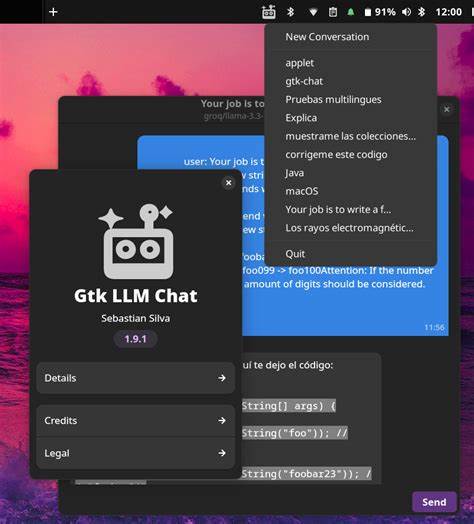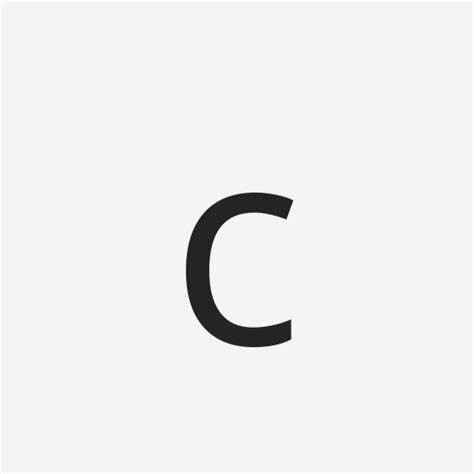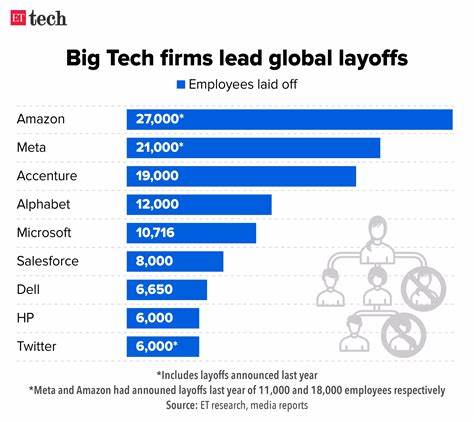In der pulsierenden Metropole New York hat ein erschütternder Fall von Entführung und Folter für Schlagzeilen gesorgt. Ein italienischer Bitcoin-Investor wurde in einer luxuriösen Townhouse-Wohnung fast drei Wochen lang festgehalten und brutal misshandelt – all dies im Kampf um den Zugriff auf seine Bitcoin-Wallet, die Millionen wert ist. Diese dramatischen Ereignisse betonen nicht nur die dunkle Seite der Kryptowährungswelt, sondern zeigen auch das steigende Risiko, mit dem Investoren und Unternehmer in diesem Sektor konfrontiert sind. Am 27. Mai 2025 wurde William Duplessie, ein 33-jähriger Mann mit Verbindungen sowohl zur Schweiz als auch zu Miami, von der Polizei in New York festgenommen.
Er ist der dritte Verdächtige, der im Zusammenhang mit der Entführung des italienischen Opfers namens Michael Valentino Teofrasto Carturan angeklagt wurde. Duplessie hatte nach der Festnahme von zwei weiteren Verdächtigen mehrere Tage mit den Behörden verhandelt und sich letztlich freiwillig der Polizei gestellt. Die Anklage gegen ihn umfasst schwerwiegende Vorwürfe wie Entführung, schwere Körperverletzung, unrechtmäßige Freiheitsberaubung und Waffenbesitz. Der Fall selbst begann dramatisch, als Michael Carturan am frühen Morgen des 23. Mai aus dem von ihm gefangengehaltenen Townhouse in Manhattans NoLIta-Viertel fliehen konnte.
Das Haus, ein 17-Zimmer-Anwesen in der Prince Street, ist ein Symbol für Luxus mit einer Mietpreisvorstellung von etwa 75.000 US-Dollar pro Monat, die aufzeigt, in welchem Umfeld sich die Tat abgespielt hat. Zum Glück konnte Carturan einen nahegelegenen Verkehrspolizisten ansprechen, der sofort Alarm schlug. Die Polizei konnte danach die wahren Grausamkeiten aufdecken, die sich in den Wochen zuvor in den Mauern dieses Hauses abgespielt hatten. Die Misshandlungen, denen Carturan ausgesetzt war, sind verstörend.
Er wurde mit elektrischen Kabeln gefesselt, mit einer Waffe ausgepeitscht und mehrfach mit einem Taser gequält. Die Angreifer setzten ihn verschiedenen Formen von Misshandlungen aus, darunter das Untertauchen seiner Füße in Wasser, das Zwingen zum Crack-Konsum und verbale Drohungen gegen ihn und seine Familie. Besonders erschreckend sind Berichte, dass er teilweise nackt und über dem Vorsprung des fünften Stockwerks des Hauses aufgehängt wurde – eine weitere brutale Eskalation, um ihn zur Herausgabe der Zugangsdaten zu seiner Bitcoin-Wallet zu zwingen. Die Verbrechen spiegeln eine erschreckende Entwicklung wider, die als „Wrench Attacks“ bekannt ist. Dies sind speziell brutale Angriffe, bei denen hochrangige Akteure der Kryptowährungsbranche entführt, gequält oder anderweitig erpresst werden, um Zugang zu deren digitalen Vermögen zu erhalten.
Da immer mehr Investoren ihre Schlüssel auf physischen Geräten speichern, um Hackerangriffe zu entgehen, steigt gleichzeitig das Risiko, dass sie selbst Opfer von Gewalt werden. Die Verbindungen zwischen den Verdächtigen im Fall Carturan bleiben bislang teilweise unklar. Neben William Duplessie wurde bereits John Woeltz festgenommen, ein 37-jähriger Krypto-Investor mit Wurzeln in Kentucky. Beide Männer scheinen sich in der Welt der Kryptowährungsinvestitionen bewegt zu haben, möglicherweise überlappend in bestimmten Kreisen. Eine ehemalige mutmaßliche Verdächtige, Beatrice Folchi, wurde kurz nach der Festnahme freigelassen und wird aktuell nicht weiter strafrechtlich verfolgt.
John Woeltz ist in der Kryptowährungs-Community kein Unbekannter. Seine berufliche Laufbahn begann in Kentucky, führte ihn aber in die Technologie-Zentren Kaliforniens und darüber hinaus. Woeltz hat sich unter anderem in Hackathons engagiert, bei denen er mit seinem Team Lösungen zur Stimmrechtsvertretung entwickelte, und hat bedeutende finanzielle Beiträge zur Förderung von Tech-Unternehmen in seiner Heimatregion geleistet. Trotz dieser positiven öffentlichen Rolle werfen die aktuellen Anschuldigungen ein neues Licht auf sein Umfeld und die Schattenseiten der Blockchain-Industrie. William Duplessie wiederum weist eine bewegte Vergangenheit auf, die von einem extravaganten Lebensstil, Streitereien mit Leasingfirmen und Verkehrsdelikten geprägt ist.
Er ist Mitgründer des Pangea Blockchain Fund mit Sitz in der Schweiz, einer Investmentgesellschaft, die sich auf Blockchain-Lösungen spezialisiert hat und 2019 mit einem Startkapital von 19 Millionen US-Dollar gegründet wurde. Trotz des anfänglichen Erfolgs scheint der Fonds aktuell seine Positionen zu liquidieren, was auf eine unsichere oder rückläufige Entwicklung hindeuten könnte. Die Tatsache, dass ein Blockchain-Investor und Unternehmer direkten Verbindungen zu einem der Hauptverdächtigen in einem derart brutalen Fall von Erpressung und Gewalt hat, wirft Fragen über die Sicherheitslage in dieser schnell wachsenden Branche auf. Besonders in Europa, und hier vor allem in Frankreich, wächst die Zahl der „Wrench Attacks“ gegen prominente Akteure. Fälle von Entführungen, Gewaltandrohungen und Erpressungen häufen sich, was die Branche dringend vor Herausforderungen stellt.
Die Auswirkungen dieser Angriffe reichen über die unmittelbaren Opfer hinaus und treffen die gesamte Kryptowährungs-Gemeinschaft. Sie erschüttern das Vertrauen in die Sicherheit digitaler Vermögenswerte und tragen zur Verunsicherung von Investoren bei. Kryptowährungen gelten zwar als zukunftsträchtige Anlagen, doch die Kombination aus technologischem Fortschritt und krimineller Energie schafft ein Umfeld, das alles andere als risikolos ist. Gerade angesichts der Sensibilität der gespeicherten Daten sind physische Sicherheitsmaßnahmen und rechtliche Schutzmechanismen unerlässlich. Es zeigt sich, dass die Gefahr nicht nur von Cyberkriminellen ausgeht, sondern auch von organisierten Banden, die skrupellos Gewalt einsetzen, um an Krypto-Vermögen zu gelangen.
Hierbei wird die Abhängigkeit von menschlichem Wissen über Wallet-Passwörter zum Sicherheitsrisiko. In den USA reagieren Behörden mittlerweile mit zunehmender Aufmerksamkeit auf diese Fälle. Die New Yorker Polizei, unter der Leitung von Polizeikommissarin Jessica S. Tisch, geht mit hoher Priorität gegen diese Art von Verbrechen vor. Die Ermittlungen im Fall Carturan haben gezeigt, dass die Täter nicht nur bereit waren, dramatische Gewaltexzesse auszuüben, sondern, dass sie auch gut organisiert und überregional vernetzt sind.
Der Fall macht auch deutlich, wie eng die Krypto-Branche mit traditionellen kriminellen Strukturen verwoben sein kann. Trotz aller Fortschritte und Legitimität, die diese Branche in den letzten Jahren erlangt hat, bleibt sie anfällig für Ausbeutung und kriminelles Verhalten. Die Kombination aus hoher Anonymität, schwer fassbaren Verantwortlichen und wertvollem Vermögen macht die Szene zum Ziel für verschiedenste Arten von Straftaten. Zusätzlich unterstreicht der Fall auch die Bedeutung von internationaler Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung. Da die Verdächtigen Verbindungen zu mehreren Bundesstaaten und sogar ins Ausland haben, zeigt sich, dass länderübergreifende Ermittlungen und Informationsaustausch entscheidend sind, um solche Verbrechen erfolgreich aufzuklären.
Während William Duplessie in Manhattan ohne Kaution festgehalten wird und Gerichtsverfahren gegen ihn und seine mutmaßlichen Mittäter anstehen, bleibt Michael Carturan ein Beispiel für die Opfer, die hinter den Schlagzeilen oft vergessen werden. Seine Widerstandskraft und sein Mut, sich aus dieser lebensbedrohlichen Lage zu befreien, haben möglicherweise viele weitere schwere Verbrechen verhindert. Der Fall erinnert nicht nur an die Gefahren innerhalb der Kryptowelt, sondern auch an die Notwendigkeit umfassender Sicherheitsvorkehrungen – physisch, digital und juristisch. Investoren und Unternehmen müssen die Risiken erkennen und entsprechend handeln, um sich gegen solche kriminellen Akte zu wappnen. Nur so kann das Vertrauen in eine innovative, aber zugleich verletzliche Branche langfristig gestärkt werden.
Abschließend zeigt die Verhaftung eines weiteren Verdächtigen, dass die Polizei entschlossen ist, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die juristischen Prozesse entwickeln und welche Lehren die Kryptowährungs-Community aus diesem aufrüttelnden Fall zieht. Klar ist jedoch, dass die Schattenseiten der Digitalisierung auch im Finanzsektor sichtbarer werden und umfassende Gegenmaßnahmen notwendig sind, um derartige Verbrechen zu verhindern.