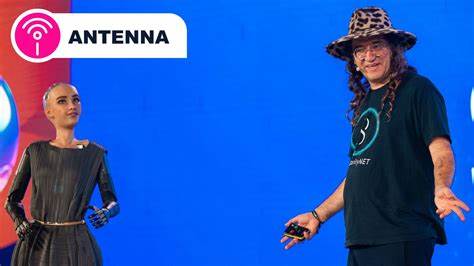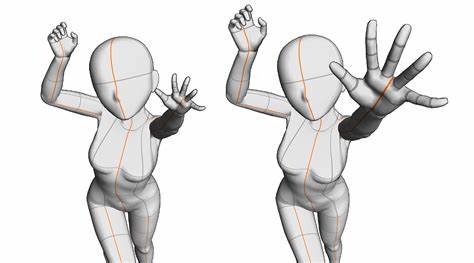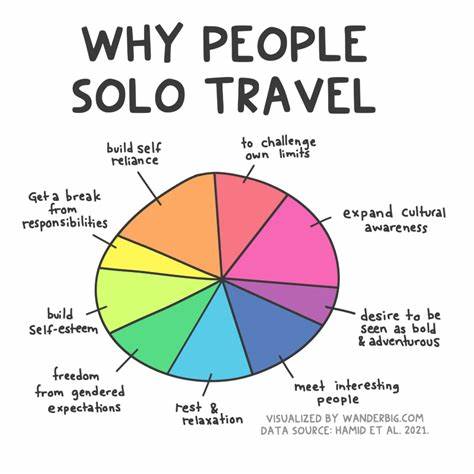Der Begriff „Artificial General Intelligence“ oder kurz „AGI“ hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen und steht im Zentrum zahlreicher Diskussionen über die zukünftige Entwicklung künstlicher Intelligenz. Doch wer hat diesen Begriff eigentlich geprägt und wie ist er entstanden? Die Antwort darauf ist facettenreich und zeugt von einer Zusammenarbeit verschiedener Persönlichkeiten in der KI-Forschung. Die Ursprünge von AGI lassen sich grob auf die frühe Zeit des 21. Jahrhunderts zurückverfolgen, genauer gesagt auf das Jahr 2002. Zu jener Zeit waren Ben Goertzel und Cassio Pennachin als Herausgeber eines Buches tätig, das sich mit weitreichenden Ansätzen zur Schaffung leistungsfähiger künstlicher Intelligenz beschäftigte.
Das Ziel war es, eine Form der Intelligenz zu beschreiben, die umfassendere, menschenähnliche kognitive Fähigkeiten besitzt – nicht begrenzt auf spezielle Aufgaben, wie es bei vielen heutigen Anwendungen der Fall ist. Das Arbeitsbuch trug zunächst den vorläufigen Titel „Real AI“, doch dieser wurde bald als zu kontrovers eingeschätzt. Im Austausch mit Kollegen und Freunden suchten Goertzel und Pennachin nach einem treffenderen Begriff, der die umfassende Natur dieser Intelligenz besser widerspiegeln würde. Shane Legg, ein KI-Forscher, der zuvor im Umfeld Goertzels gearbeitet hatte, schlug schließlich den Begriff „Artificial General Intelligence“ vor. Obwohl Goertzel zunächst nicht restlos begeistert war, erkannte er bald, dass der Vorschlag im Vergleich zu anderen Alternativen am besten passte.
Mit der Veröffentlichung des Buches „Artificial General Intelligence“ im Jahr 2005 trug diese Terminologie dazu bei, das Konzept in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu etablieren. Von da an nutzte Ben Goertzel den Ausdruck immer häufiger und trug maßgeblich zu dessen Verbreitung bei. Sie entwickelten damit ein Sprachrohr für das Ziel, Systeme zu entwickeln, die nicht nur in einem eng begrenzten Bereich exzellent funktionieren, sondern über ein breites Spektrum menschlicher Denkfähigkeiten verfügen – von logischem Schlussfolgern über kreatives Denken bis hin zu komplexer Problemlösung. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Begriff „AGI“ nicht vollständig von Ben Goertzel oder seinem Team alleine erfunden wurde. Beispielsweise nutzte Mark Gubrud, ein Forscher aus Maryland, bereits 1997 den Begriff in einem Artikel, der sich mit der Zukunft von Technologie und deren Risiken auseinandersetzte.
Dies zeigt, dass einzelne Schlagwörter oft nicht isoliert entstehen, sondern sukzessive durch verschiedene Personen und Zusammenhänge geprägt und geformt werden. Vor der Etablierung des Begriffs AGI gab es bereits andere Bezeichnungen für das, was heute mit AGI gemeint ist. Ray Kurzweil zum Beispiel sprach von „strong AI“ im Gegensatz zu „weak AI“. Zwar beschreibt „strong AI“ ähnlich die Idee einer umfassend intelligenten Maschine, allerdings brachten Goertzel und Pennachin mehrere Gründe dagegen vor. Zum einen empfindet man im Umfeld der künstlichen Intelligenz den Begriff „weak AI“ als herabsetzend für spezialisierte Systeme, die durchaus beeindruckende Fähigkeiten zeigen, wie beispielsweise Deep Blue im Schach.
Zum anderen hat „strong AI“ in der Philosophie eine festgelegte Bedeutung. Es basiert auf John Searles Hypothese, dass eine Maschine, die sich intelligent verhält, auch wirklich ein Bewusstsein oder einen Geist besitzen müsse. Dies ist eine kontroverse und tiefgründige Fragestellung, die philosophische Debatten befeuert, aber für praktische technologische Entwicklungen oft weniger handlungsrelevant ist. Der Vorteil des Begriffs „Artificial General Intelligence“ liegt in seiner klaren Verbindung zum etablierten Begriff „Artificial Intelligence“ und der Einbeziehung des Begriffs „general“, das aus der Intelligenzforschung bekannt ist. Das „g-Faktor“-Konzept aus der Psychologie beschreibt allgemeine Intelligenz als eine Art Kernfähigkeiten, die verschiedene spezielle intellektuelle Leistungen miteinander verbinden.
AGI strebt danach, eine solche allgemeine Intelligenz künstlich zu erreichen. Allerdings hat auch „AGI“ seine Herausforderungen und Unschärfen im Begriff. So täuscht der Ausdruck „Artificial“ darüber hinweg, dass es bei AGI nicht nur um technische Artefakte geht, sondern um Systeme, die potenziell eigenständig denken und lernen. Der Begriff „General“ suggeriert eine vollumfängliche Universalität, die in der Realität kaum erreichbar ist, da selbst menschliche Intelligenz auf bestimmte Fähigkeiten und Kontexte spezialisiert ist – und das gilt erst recht für künstliche Systeme. Weiterhin wird „Intelligence“ bis heute nicht einheitlich definiert.
Der Begriff ist vielschichtig, umfasst Aspekte von Lernen, Problemlösen, Wahrnehmung, Sprache und mehr. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen treffen hier auf komplexe theoretische und praktische Fragen. Shane Legg und Marcus Hutter veröffentlichten eine Arbeit, die über siebzig unterschiedliche Definitionen von Intelligenz zusammenträgt, was die Vielseitigkeit und Komplexität des Begriffs unterstreicht. Trotz aller Kritik und der Unzulänglichkeit der Termini hat sich „AGI“ in der KI-Forschung und auch in der populärwissenschaftlichen Diskussion etabliert. Er bezeichnet die große Vision einer künftigen Künstlichen Intelligenz, die flexibel, adaptiv, kreativ und menschenähnlich umfassend denkt – eben eine „allgemeine Intelligenz“.
Die Weiterentwicklung und Definition von AGI bleibt ein lebendiges Thema. Forscherinnen und Forscher arbeiten daran, formalere Beschreibungen und Konzepte zu schaffen, etwa durch die Unterscheidung von „Generality“ und „Intelligence Degree“, um auszudrücken, wie breit ein System tatsächlich einsetzbar ist und wie hoch seine Fähigkeiten innerhalb dieser Bereiche sind. Da die Diskussionen über die potenziellen Auswirkungen von AGI auf Gesellschaft, Wirtschaft und Ethik intensiviert werden, ist es wichtig, den Ursprung und die Bedeutung des Begriffs richtig einzuordnen. Die Debatten zeigen, dass die Entwicklung von AGI nicht nur technische Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch philosophische, ethische und gesellschaftliche Fragen aufwirft. Zuletzt ist festzuhalten, dass Terminologie in der Wissenschaft oft mehr ist als nur eine sprachliche Angelegenheit.
Sie formt Denkweisen, beeinflusst Forschungsrichtungen und schafft gemeinsame Bezugspunkte. Der Fall von „AGI“ illustriert exemplarisch, wie ein Begriff entstehen kann, sich entwickelt und letztlich zum Symbol eines großen Traums der menschlichen Intelligenzforschung wird. Die Geschichte von AGI ist somit nicht allein die eines Wortes, sondern von einer Gemeinschaft, die versucht, Maschinen mit Fähigkeiten zu erschaffen, die die menschliche Intelligenz umfassend nachahmen oder sogar übertreffen können. Ein zukunftsweisendes Unterfangen, dessen Wurzeln in Zusammenarbeit, Diskussion und Austausch liegen – und dessen Begrifflichkeit bis heute weiterlebt und sich weiterentwickelt.