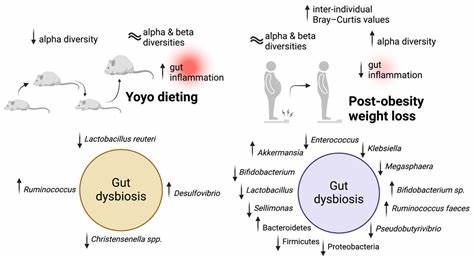In der Start-up-Welt und Produktentwicklung wird oft die Frage gestellt: „Ist dein Produkt ein Vitamin oder ein Schmerzmittel?“ Diese Metapher suggeriert, dass nur Produkte, die akute Probleme lösen, wirklich bedeutend und marktfähig sind. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich dieses Mantra als teilweise irreführend und begrenzt die Perspektive auf Innovation und Kundennutzen. Denn nicht jedes erfolgreiche Produkt wirkt wie ein schmerzstillendes Mittel. Einige sind vielmehr wertvolle Begleiter, die still und stetig Freude, Nutzen oder Gewohnheit im Alltag stiften, ohne dass der Nutzer einen brennenden Notfall erleben muss. Die Ursprungsidee von Schmerzmitteln (Painkillern) ist nachvollziehbar: Sie adressieren ein drängendes, unmittelbares Problem, das gelöst werden muss.
Sie lindern Schmerzen oder beseitigen Hindernisse, die das Leben der Menschen deutlich erschweren. Ein Produkt, das dieses Kriterium erfüllt, hat oft eine klare und messbare Dringlichkeit und lässt sich leicht vermarkten – denn wer verspürt keinen Schmerz, braucht auch kein Schmerzmittel. Das Risiko bei diesem Ansatz ist jedoch, dass potenziell wertvolle Innovationen, die eher subtilen oder langfristigen Mehrwert liefern, im Schatten stehen. Der Vergleich mit Vitaminen symbolisiert Produkte, die nicht akut notwendig sind, aber einen langfristigen Nutzen bringen oder die Lebensqualität verbessern. Vitamine werden präventiv eingenommen, sie sind Teil einer gesunden Lebensweise, aber ihr Nutzen ist weniger unmittelbar spürbar.
Oft werden Vitamin-Produkte in der Tech-Branche als weniger spannend wahrgenommen, weil der Nutzen für den Kunden schwerer greifbar ist und sich nicht in einer plötzlichen Problemlösung manifestiert. Das führt leider dazu, dass viele Innovatoren nicht den Mut haben, Produkte zu bauen, die nicht sofortige Schmerzen lindern, sondern beständig Mehrwert schaffen. Dabei ist der Alltag von Millionen Menschen voll mit Anwendungen, Diensten und Gegenständen, die weder Feuerwehr noch Schmerzmittel sind, aber dennoch nicht mehr wegzudenken sind. Beispiele wie Instagram, Pinterest, Spotify oder Reddit illustrieren, dass Produkte, die soziale Interaktion, Inspiration, Unterhaltung oder Information fördern, massiven Erfolg haben können, obwohl niemand „brannte“ vor dringendem Bedürfnis danach. Menschen greifen freiwillig, gerne und regelmäßig auf diese Angebote zu, weil sie Lust bereiten, den Alltag bereichern oder positive Gewohnheiten unterstützen.
Das Narrativ des Schmerzmittels verkennt, dass Wertschöpfung auch durch Freude, Inspiration und dauerhafte Nutzungsgewohnheiten entsteht. Solche Produkte müssen nicht dramatisch sein oder die Existenz retten. Vielmehr überzeugen sie durch Attraktivität und Relevanz, die im Alltag eine Rolle spielen, ohne das Leben „brennen“ zu lassen. Der Druck, alles als Schmerzmittel zu positionieren, führt zudem häufig dazu, dass Produkte künstlich mit Dringlichkeit aufgeladen werden, um Investoren oder Nutzer zu überzeugen – ein Effekt, der Authentizität und nachhaltigen Erfolg gefährdet. Ein Blick auf Werkzeuge im Alltag bringt diese Einsicht auf den Punkt: Ein Hammer ist erst dann dringend, wenn man einen Nagel einschlagen will; vorher liegt er einfach als nützliches Hilfsmittel da.
Eine Taschenlampe ist der treue Begleiter in der Dunkelheit, ihr Wert lässt sich bei Tageslicht kaum ermessen. Solche Werkzeuge gelten weder durchgängiger Nutzung als essentiell, noch revolutionieren sie ständig das tägliche Erleben. Sie haben jedoch ihren festen Platz und werden gebraucht, wenn es zählt. Das zeigt, dass der Nutzen eines Produkts häufig kontextabhängig ist und sich nicht allein über unmittelbare Problemlösungen definieren lässt. Start-ups und Produktentwickler sind daher gut beraten, das Denken völlig vom Schmerzmittel-Vitamin-Dualismus zu lösen.
Statt künstlich Dringlichkeit zu konstruieren, sollte der Fokus auf echter Wertschöpfung liegen, sei diese nun durch Problemlösung, Bedürfnisbefriedigung, Gewohnheitsbildung oder Freude gegeben. Ehrliches Verständnis für die Nutzerbedürfnisse und die Schaffung eines Produkts, das auf nachhaltige Weise Bedeutung erlangt, ist oft erfolgreicher als der Kampf um den Status eines Schmerzmittels. Die Psychologie hinter Produktnutzung und Kundenbindung zeigt, dass Menschen oft gerade jene Produkte schätzen, die auf angenehme Art und Weise Teil ihres Lebens werden. Produkte können Gewohnheiten fördern, Identität stiften oder einfach Wohlfühlmomente schaffen. Der Drang, jede Innovation als „unverzichtbar bei akutem Leid“ zu definieren, ignoriert diese Dimensionen.
Erfolgreiche Unternehmen wie Apple, Netflix oder Spotify zeigen, dass enorme Nutzerzahlen und wirtschaftliche Erfolge auch durch Produkte möglich sind, die keinen akuten Schmerz adressieren. Wenn Gründer und Produktmanager offen für eine breitere Perspektive sind, können sich völlig neue Chancen auftun. Es geht darum, echte Bedürfnisse zu erkennen – seien sie emotional, sozial, unterhaltend oder praktisch – ohne sie immer durch eine Dringlichkeitsschablone zu pressen. Diese Haltung fördert authentische Innovationen, die Nutzer nicht nur kurzfristig binden, sondern dauerhaft begleiten und bereichern. Nicht zuletzt eröffnet das Loslassen der Schmerzmittel-Metapher auch erweiterte Möglichkeiten im Marketing und Positionierung.
Produkte, die als „Vitamin“ oder höherwertiger Begleiter verstanden werden, brauchen eine andere Kommunikationsstrategie. Sie punkten mit Storytelling, Lifestyle-Bezug und der Vermittlung von Lebensqualität, statt nur mit Problemlösung. Markenbindung entfaltet sich so auf einer emotionalen Ebene, die nachhaltigen Unternehmenserfolg stützen kann. Zusammengefasst zeigt sich, dass der oft gehörte Appell, alles als Schmerzmittel zu definieren, eine zu enge Sichtweise darstellt. Die wirklichen Bedürfnisse der Nutzer sind vielfältiger.
Ein guter Teil erfolgreicher und einflussreicher Innovationen schafft Werte, die weder akut noch zwingend lebensrettend sind, sondern durch Nutzen, Freude und Gewohnheit überzeugen. Produktschaffende sollten diesen differenzierten Blick als Chance begreifen, authentische und dauerhafte Wertangebote zu entwickeln. Denn es ist vollkommen in Ordnung, wenn das eigene Produkt nicht wie Tylenol wirkt, sondern auf seine ganz eigene Weise Bedeutung gewinnt.
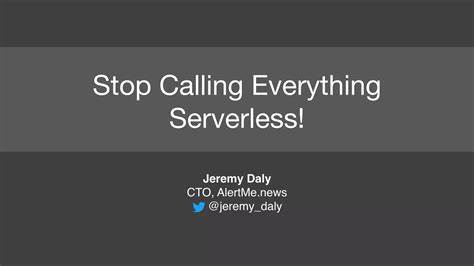


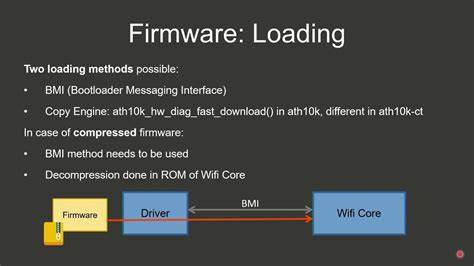
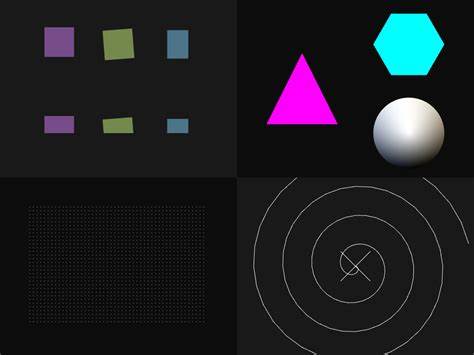
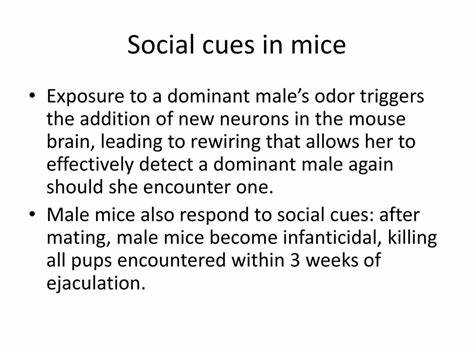
![Chromaplane Unlocked: The Electromagnetic Synth You Must Try [video]](/images/60088BD2-2CFF-446D-B4F2-FE8B8263DD13)