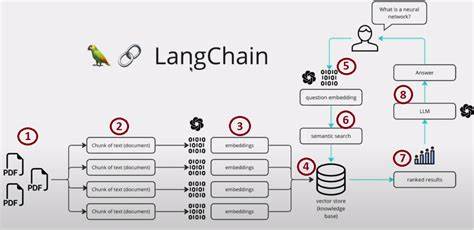Zwischen den Schatten kolonialer Kriegsschauplätze erhebt sich eine kaum bekannte, aber tief berührende Geschichte, die die Verbindung zwischen Vietnam und Marokko auf einzigartige Weise verkörpert. Es ist die Geschichte von marokkanischen Soldaten, die aus den Reihen der französischen Kolonialtruppen desertierten, den Weg in die vietnamesische Widerstandsbewegung fanden und in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hanoi eine neue Heimat errichteten. Ein Dorf, das heute noch von der außergewöhnlichen Lebensreise dieser Menschen erzählt und im Laufe der Jahre zum Sinnbild für Widerstand, kulturelle Vermischung und Identität wurde. Diese Geschichte spiegelt tiefgehende Facetten des französischen Kolonialismus wider und eröffnet ein Fenster in das Leben jener, die fern der Heimat für eine Unabhängigkeit kämpften, die auch für sie selbst heimische Bedeutung gewann. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht die Zeit zwischen 1947 und 1954, in der Frankreich mit allen Mitteln versuchte, seine Kolonialherrschaft über Indochina zu bewahren.
Über 120.000 Männer aus Nordafrika, vor allem aus Marokko, wurden in diesem Konflikt mobilisiert. Offiziell galt die Rekrutierung als freiwillig, doch hinter diesem Label verbarg sich häufig Zwang, soziale Not, Hoffnung auf ein besseres Leben oder schlichtweg die Verlockung des Abenteuers in fernen Ländern. Zika Hajji, heute 70 Jahre alt, erzählt bewegend von der Reise seines Vaters, der als Gefängniswärter Widerstandskämpfer in Marokko unterstützte, jedoch vom französischen Militär mit der Wahl zwischen der Guillotine und dem Kampf in Vietnam gezwungen wurde. Ein Albtraum, der ihn nicht brach, sondern vielmehr zu einem Wechsel auf die andere Seite des Krieges bewegte.
Diese marokkanischen Soldaten fanden sich in einer paradoxen Situation wieder: Eingezogen, um für das französische Kolonialregime zu kämpfen, begannen sie zunehmend, die vietnamesische Unabhängigkeitsbewegung, die Viet Minh, aktiv zu unterstützen. Die Viet Minh nutzten eine ausgeklügelte Propaganda, die sich nicht nur an die lokalen Vietnamesen, sondern auch an die ausländischen Kolonialsoldaten richtete. Radio Hanoi sendete ihre Botschaften auch in Französisch und appellierte an das gemeinsame koloniale Schicksal und den Wunsch nach Freiheit. Die Verehrung gegenüber Abd el-Krim al-Khattabi, einer marokkanischen Widerstandslegende, wurde als verbindendes Symbol genutzt, um die Soldaten zur Desertion zu bewegen. Die damalige Verbannung ihres eigenen Königs Mohammed V.
durch die Franzosen entfachte weiteren Zorn und half, die Loyalitäten zu verschieben. Unter schwierigsten Bedingungen und häufig unter Einsatz ihres Lebens setzten viele Soldaten dem Kampf gegen die französischen Truppen ein Ende und schlossen sich den Viet Minh an, um für ihre gemeinsame Befreiung zu kämpfen. Die strategische und emotionale Bedeutung dieses Schrittes kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Zum ersten Mal erlebten diese Männer Anerkennung als Freiheitskämpfer, nicht als bloße Kolonialsoldaten oder austauschbare Ressourcen eines Imperialismus. Mit Hilfe von Verbindungen zwischen Kommunisten in Marokko und Vietnam konnten sie ihre neue Rolle akzeptieren und sich offiziell integrieren. Nach dem Ende des Indochina-Kriegs 1954 und der Niederlage Frankreichs waren die marokkanischen Deserteure nicht länger willkommen in ihrem Herkunftsland; die koloniale Verwaltung verweigerte ihnen die Rückkehr.
So entstanden in Vietnam Familien, die vietnamesisches und marokkanisches Erbe vermischten. In Ba Vi, einem kleinen Ort nahe Hanoi, ließen sie sich nieder und bauten eine Siedlung, die einen einzigartigen architektonischen Schatz beherbergt: Das Tor von Marokko mit drei hohen maurischen Bögen und arabischen Inschriften, welches noch heute an die kulturelle Verschmelzung und gemeinsame Geschichte erinnert. Das Leben in diesem neu entstandenen Dorf war ebenso geprägt von Routine wie von fortwährenden Kriegen. Die politischen Entwicklungen durch die Genfer Abkommen, die Vietnam in einen kommunistischen Norden und einen westlich orientierten Süden zerteilten, brachten den Vietnamkrieg und die amerikanischen Luftangriffe mit sich. Trotz der Gefahr und Entbehrungen blickten viele der marokkanischen Familien fest entschlossen in die Zukunft.
Erst 1972 kam ein entscheidender Wendepunkt: König Hassan II. erlaubte den veteranischen Kriegsfreiheitskämpfern und ihren Familien die Rückkehr nach Marokko. Die Nachricht löste eine Welle der Hoffnung aus, ausgelöst durch die zunehmende Härte des Krieges in Vietnam und den Wunsch, die neue Generation in Sicherheit und Frieden aufwachsen zu lassen. Doch die Rückkehr war kein leichter Weg. Die Reise führte durch viele Länder, oft unter prekären Bedingungen, und die Ankunft in Marokko bedeutete eine weitere Herausforderung.
Die Familien, die zurückkehrten, wurden häufig in ihrer Heimat misstrauisch beäugt, in einer Welt, die sie kaum noch kannten. Besonders für die Kinder, die vietnamesisch geprägt waren, war die kulturelle und sprachliche Integration schwierig. Dazu kam, dass sie von Nachbarn für Asiaten gehalten wurden – eine Verwechslung, die jeder der Rückkehrer aufklärte. Besonders in einem Dorf in der Nähe von Rabat, das später als „chinesisches Dorf“ bezeichnet wurde, lebten diese Familien in beengten Verhältnissen und mussten sich ihren Platz in der Gesellschaft erst erkämpfen. Gleichzeitig blieben manche Familien in Vietnam; sie hatten keine offizielle Möglichkeit für die Rückkehr oder entschieden sich aus Liebe zu ihrer Heimat, dort zu bleiben.
Le Tuan Binh, Sohn eines marokkanischen Freiheitskämpfers, erzählt von den Herausforderungen, seinen Hintergrund anzuerkennen und hegt heute den Wunsch, die Verbindung zu Marokko durch spätere Generationen weiterzuführen. Seine Tochter lebt inzwischen in Marokko und versucht sich in einer Welt, die für sie fremder ist als für die Großeltern, zurechtzufinden. Während die Jahre vergingen, verblassten in Vietnam die vietnamesischen Elemente dieser Familien langsam. Ältere Generationen pflegten Traditionen und Bräuche, veranstalteten gemeinsame Feiern wie das vietnamesische Neujahrsfest und das muslimische Eid al-Adha in Marokko. Neben der Bewahrung gemeinsamer Werte und Geschichte entstand ein neues kulturelles Geflecht, das vietnamesische und marokkanische Elemente ineinander verwob.
Die heute meist älteren Bewohner der vietnamesischen Dorfgemeinschaft erinnern sich mit Wärme an ihre gemeinsame Vergangenheit und pflegen noch immer vietnamesische Pflanzen und Rezepte, die sie in ihr marokkanisches Umfeld integriert haben. Hong May, eine Witwe eines marokkanischen Veteranen, vereint symbolisch beide Kulturen: Mit traditionellen vietnamesischen Kleidern und marokkanischem Schmuck veranschaulicht sie das Leben zwischen zwei Welten. Für sie ist Marokko längst die Heimat geworden – trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit Sprache und Kultur, die sie und andere Frauen der Gemeinde bewältigten. Die Berichte von früherer Armut, Heimweh und familiären Verlusten werden oft beiseitegeschoben; gedeihen tun eher das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Freude an gemeinsamen Ritualen. Heute treffen sich die Nachfahren dieser Begebenheit und halten das Erbe lebendig – sowohl in formellen Veranstaltungen wie den Feierlichkeiten an der vietnamesischen Botschaft in Rabat als auch im alltäglichen Leben.