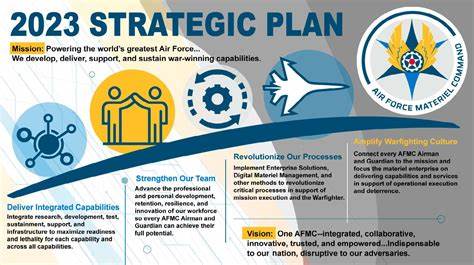Die Welt steht an einem entscheidenden Wendepunkt in ihrer historischen Beziehung zur Natur. Die zunehmende ökologische Knappheit und die steigenden Umweltgefahren fordern verstärkte Anstrengungen zum Schutz unseres Planeten. Insbesondere die Entwicklung und Umsetzung grüner Technologien werden von vielen als Schlüssel zur Rettung der Erde angesehen. Doch ein genauerer Blick auf den globalen Wettlauf um grüne Innovationen wirft Fragen auf, ob diese Konkurrenz wirklich die erhofften nachhaltigen Veränderungen bringen wird oder ob sie am Ende eher Wohlstand auf Kosten der Umwelt fördert. Seit den 1970er Jahren hat sich die Umwelt weltweit dramatisch verändert.
Mehr als drei Viertel der Landflächen und über zwei Drittel der Meeresflächen wurden durch menschliche Aktivitäten beeinflusst. Klimawandel, Umweltverschmutzung, Verlust von Artenvielfalt und das Eindringen invasiver Spezies haben zu einem massiven Rückgang der natürlichen Ökosystemleistungen geführt. Insbesondere sind 14 von 18 globalen Ökosystemdienstleistungen, die unter anderem das stabile Klima, die Bestäubung oder die Qualität von Frischwasser umfassen, stark zurückgegangen. Die Bestände von Wildtieren haben im Durchschnitt um 73 Prozent abgenommen, was die Schwere der Situation verdeutlicht. Vor diesem Hintergrund muss die Frage gestellt werden, wie Wirtschaften auf diese Probleme reagieren können.
Ökonomisch betrachtet kann ein hoher Wert auf den Schutz der Natur Innovationen anregen und den Einsatz nachhaltiger Technologien fördern. Steigende Kosten für die Nutzung natürlicher Ressourcen, sei es Land, Wasser oder Rohstoffe, können Unternehmen und Länder dazu zwingen, effizientere und umweltschonendere Alternativen zu entwickeln und zu implementieren. Beispielsweise kann die Verknappung von frischem Wasser oder landwirtschaftlicher Fläche den Übergang zu ressourcensparenden Anbaumethoden beschleunigen. Doch leider setzen viele Länder nach wie vor auf die Ausbeutung der Natur, halten Umweltkosten künstlich niedrig und ignorieren langfristige Folgen. Die Umwandlung von Wäldern in Agrarflächen, der Abbau von Bodenschätzen auf dem Meeresgrund oder das weitverbreitete Verschmutzen der Meere durch Plastik sind nur einige Beispiele.
Diese Strategien führen zu erheblichen Kosten für Umwelt und Gesellschaft, die oftmals erst spät oder gar nicht berücksichtigt werden. Es kristallisieren sich zwei gegensätzliche Trends heraus: Einerseits gibt es Staaten, die Umweltschäden weiterhin billigend in Kauf nehmen, um kurzfristige ökonomische Vorteile zu sichern. Andererseits ringen Staaten um Führungspositionen im Bereich grüner Technologien, Innovationen und Märkte. Diese Wettbewerbsdynamik wird häufig als „grüner Wettlauf“ bezeichnet und könnte zu mehr Wohlstand, jedoch nicht zwangsläufig zu mehr Nachhaltigkeit führen. Ein zentrales Problem ist die Unterbewertung der Natur und ihrer Dienste, die größtenteils unentgeltlich bereitgestellt werden.
Solche Leistungen wie ein stabiles Klima, die Ernährungssicherung und Schutzfunktionen für Mensch und Umwelt werden in den meisten Märkten und politischen Entscheidungen kaum berücksichtigt. Im Gegenteil, zahlreiche Subventionen und wirtschaftliche Anreize fördern weiterhin umweltschädliche Aktivitäten, zum Beispiel die Förderung von Kohle, Pestiziden oder Rodungen. Weltweit belaufen sich diese umweltschädlichen Subventionen auf rund 1,8 Billionen US-Dollar jährlich, was etwa zwei Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Diese Fehlanreize führen dazu, dass ökologische Knappheit in der Wirtschaft oft ignoriert wird. Investitionen in den Schutz, die Erhaltung oder die Wiederherstellung von Biodiversität und Lebensräumen sind bei Weitem nicht ausreichend.
Schätzungen zufolge fehlen weltweit jährlich mehr als eine halbe Billion US-Dollar, um die Biodiversitätsfinanzierung auf ein notwendiges Niveau zu heben. Unternehmen hinken hier ebenfalls hinterher, obwohl ein großer Teil der globalen Wirtschaftsleistung von intakten natürlichen Systemen abhängt. Derzeit fließen lediglich wenige Milliarden US-Dollar jährlich in nachhaltige Lieferketten, was angesichts des Ausmaßes der Naturabhängigkeit gering erscheint. Trotz dieser Herausforderungen haben einige Länder und Unternehmen erkannt, dass sie durch eine grüne Transformation Wettbewerbsvorteile erlangen können. Diese Einsicht führt zu einem globalen Rennen um technologische Vorherrschaft in Sektoren wie erneuerbare Energien, umweltfreundliche industrielle Verfahren oder auch den Handel mit CO2- und Biodiversitätszertifikaten.
Länder wie China, Deutschland, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und die USA investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um führende Positionen zu erlangen. Diese Wettbewerbsfähigkeit zeigt sich unter anderem in steigenden Patentanmeldungen, sinkenden CO2-Emissionen und verschärften Umweltvorschriften. Gleichzeitig wächst die Zahl der Unternehmen, die grüne Produkte und Dienstleistungen anbieten, weltweit. Dennoch ist diese Entwicklung regional sehr ungleich verteilt. Während die USA beispielsweise 60 Prozent aller grünen Aktien weltweit stellen, machen diese nur acht Prozent des US-Gesamtmarktes aus und liegen unter dem weltweiten Durchschnitt von neun Prozent.
Länder wie Taiwan, Deutschland, Kanada, China, Japan und Frankreich schneiden im Vergleich besser ab und sind für den globalen grünen Wettbewerb gut positioniert. Gleichzeitig wird der grüne Wettlauf durch die seit den 1980er Jahren verlangsamte Produktivitätsentwicklung angetrieben. Wirtschaftssysteme suchen nach neuen Wachstumstreibern und Chancen für Produktivitätsgewinne, die sich in aufstrebenden grünen Sektoren bieten. Zudem motivieren die enormen Schäden, die Naturkatastrophen – zu siebenzig Prozent klimabedingt – an Arbeitskraft und Wirtschaftskraft anrichten, weitere Investitionen in Umweltschutz und Risikominimierung. Regierungen reagieren auf diesen Wettbewerb mit gezielten politischen Maßnahmen.
Während in den 1990er Jahren Japan, die USA und Deutschland die wichtigsten Akteure im grünen Innovationsfeld waren, haben sich China und Südkorea inzwischen mit starke Investitionen in Solarenergie, Windkraft, Batterietechnik und Elektrofahrzeuge zu gleichberechtigten Wettbewerbern entwickelt. Auch Länder wie Indien, Frankreich, Spanien, Türkei und Polen investieren zunehmend in diese Bereiche und streben gute Marktpositionen an. Trotz des Fortschritts birgt dieser Wettbewerb auch Risiken. Die sogenannten „grüne Merkantilismus“ genannte Praxis beinhaltet, dass Länder protektionistische Maßnahmen einführen, um ihre heimische Industrie zu stärken und internationale Konkurrenz zu benachteiligen. Beispiele dafür sind Steuervorteile, Subventionen oder bevorzugte staatliche Aufträge für inländische Unternehmen.
Nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Act in den USA im Jahr 2022 haben viele Länder nachgezogen und ähnliche Politikansätze verfolgt. Solche protektionistischen Maßnahmen können den internationalen Handel untergraben, Innovationen bremsen und zu Spannungen zwischen Staaten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass diese Praktiken eher wirtschaftliche Vorteile als echte ökologische Nachhaltigkeit fördern. Die globale Umweltkrise erfordert jedoch Kooperation, koordinierte Anstrengungen und geteilte Verantwortung über Landesgrenzen hinweg. Es wird deutlich, dass die Entwicklung grüner Technologien zwar notwendig und vielversprechend ist, aber allein nicht ausreicht, um die planetaren Grenzen zu respektieren und die Umwelt nachhaltig zu schützen.
Der grüne Technikwettlauf könnte Wohlstand schaffen, aber ohne eine begleitende globale Zusammenarbeit und die richtige ökonomische Bewertung von Natur und Umweltleistungen droht er, ökologische Schäden fortzusetzen oder gar zu verschärfen. Um die volle Wirkung grüner Technologien zu entfalten, bedarf es eines Paradigmenwechsels in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Subventionen müssen weg von umweltschädlichen Branchen hin zu nachhaltigen Lösungen fließen, Umweltkosten müssen sichtbar und einkalkuliert werden, und Unternehmen müssen verstärkt Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen. Auch politische Rahmenwerke sollten internationale Handelsbarrieren abbauen und die grüne Zusammenarbeit fördern. Die Herausforderungen sind enorm – der Schutz der Biodiversität, die Eindämmung des Klimawandels und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu gewährleisten.
Dafür ist ein umfassendes Umdenken notwendig, das ökologische Tragfähigkeit ins Zentrum wirtschaftlicher Entscheidungen rückt und technologische Innovationen mit verantwortlichem Handeln verbindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale Wettlauf um grüne Technologien zwar einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit einleiten kann, aber keineswegs eine Garantie für den Schutz unseres Planeten ist. Nur durch eine enge Verknüpfung von Innovation, Kooperation und ökologischer Verantwortung lässt sich die Erde langfristig bewahren.