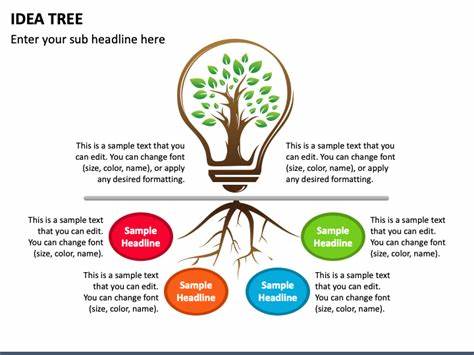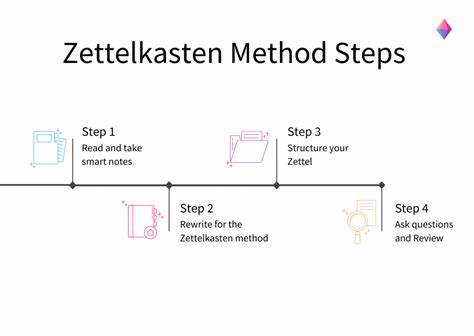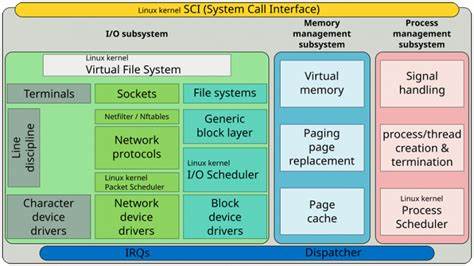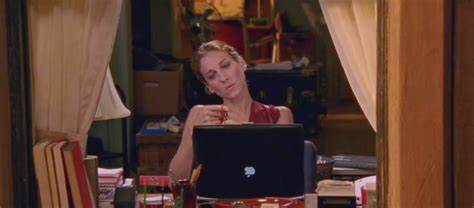Die zunehmende Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere generativer KI wie ChatGPT, hat weltweit hohe Erwartungen geweckt. Viele Experten gingen davon aus, dass solche Technologien signifikante Produktivitätssteigerungen mit sich bringen und somit sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer entlasten würden. Neue Studien betonen jedoch, dass diese Einsparungen an Arbeitszeit häufig durch die Schaffung neuer Aufgaben wieder ausgeglichen werden. Eine umfassende Untersuchung auf dem dänischen Arbeitsmarkt liefert aktuelle Einblicke in diesen komplexen Zusammenhang. Forscher der University of Chicago und der University of Copenhagen analysierten Arbeitsdaten von rund 25.
000 Beschäftigten aus 7.000 Unternehmen in Dänemark aus den Jahren 2023 und 2024. Ihr Fokus lag auf elf Berufsgruppen, die als besonders gefährdet durch Automatisierung gelten – unter ihnen Buchhalter, Softwareentwickler und Mitarbeitende im Kundensupport, die zu den „Early Adoptern“ von KI-Chatbots zählen. Diese Studie liefert eine der ersten groß angelegten empirischen Bewertungen der realen Auswirkungen generativer KI auf Beschäftigung und Löhne. Erstaunlicherweise zeigte die Untersuchung, dass trotz rascher und oft vom Arbeitgeber geförderter Einführung von KI-Tools die Gesamtarbeitszeit und die Einkommen in den untersuchten Berufen nahezu unverändert blieben.
Die statistische Analyse ermöglichte es, signifikante Effekte von mehr als einem Prozent auszuschließen. Experten führten diese Tatsache unter anderem darauf zurück, dass die tatsächlichen Produktivitätsvorteile – gemessen an der eingesparten Zeit – mit durchschnittlich nur etwa 2,8 Prozent relativ gering ausfielen, was ungefähr einer Stunde pro Woche entspricht. Eine bemerkenswerte Erkenntnis der Studie ist, dass in rund 8,4 Prozent der Fälle durch den Einsatz von KI neue Aufgaben für Arbeitnehmer entstanden, selbst bei solchen, die die Systeme nicht selbst nutzten. Diese Aufgaben sind vielfältig und umfassen beispielsweise das Überprüfen der KI-generierten Inhalte auf deren Qualität, das Erstellen präziser Eingaben, sogenannter Prompts, sowie neue Kontrollmechanismen, um beispielsweise den missbräuchlichen Einsatz von KI zu entdecken. Im Bildungsbereich berichten Lehrkräfte, dass sie zunehmend Zeit darauf verwenden müssen zu überprüfen, ob Schüler Hausaufgaben mithilfe von KI anfertigen lassen.
Diese Entwicklung legt nahe, dass der Produktivitätsgewinn infolge von KI-Einsparungen teilweise aufgewogen oder gar überkompensiert wird durch den Mehraufwand, der durch Überwachung, Qualitätskontrolle und Anpassung der Arbeitsprozesse entsteht. Die Integration von KI-Anwendungen ist innerhalb vieler Unternehmen noch in einer Lernphase, und Organisationsstrukturen haben Schwierigkeiten, das Potenzial der Technologie voll auszuschöpfen. Darüber hinaus spiegelt die Studie wider, dass nur ein kleiner Teil der eingesparten Arbeitszeit zu einem tatsächlichen Einkommensanstieg bei Beschäftigten führt. Schätzungen zufolge wird lediglich zwischen drei und sieben Prozent der Produktivitätsgewinne in höhere Löhne umgesetzt. Dies wirft grundlegende Fragen darüber auf, wer letztendlich von der Effizienzsteigerung profitiert und inwiefern die Vorteile durch KI gerecht verteilt werden.
In der wissenschaftlichen und politischen Debatte wird oft die Hoffnung vertreten, dass KI-bedingte Produktivitätssprünge langfristig zu mehr Wohlstand und besseren Arbeitsbedingungen führen können. Die Ergebnisse dieser dänischen Studie zeigen jedoch, dass die gegenwärtige Wirklichkeit differenzierter ist und die ökonomischen Effekte von generativer KI bislang eher moderat ausfallen. Die bisherige Phase der KI-Integration könnte eher als eine Übergangszeit betrachtet werden, in der Unternehmen erste Erfahrungen sammeln und lernen, wie sie die Chancen der Technologie wirksam nutzen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Stichprobe und die geographische Beschränkung der Studie auf Dänemark. Nationale Arbeitsmärkte unterscheiden sich erheblich, und gerade Länder mit unterschiedlichen Branchenstrukturen, Arbeitsgesetzen und technologischen Rahmenbedingungen könnten alternative Entwicklungspfade aufweisen.
Speziell die Kreativwirtschaft oder der freie Markt für Freelancer könnten andere Muster im Umgang mit generativer KI zeigen, die in der dänischen Datenbasis möglicherweise nicht abgebildet werden. Im Vergleich zu anderen Forschungsergebnissen fällt zudem auf, dass diese Studie deutlich geringere Produktivitätssteigerungen meldet als zum Beispiel eine im Februar 2024 veröffentlichte randomisierte Kontrollstudie, die einen Produktivitätszuwachs von durchschnittlich 15 Prozent ermittelte. Eine Erklärung liegt darin, dass die kontrollierte Studie stark auf Aufgaben fokussierte, die speziell für die Automatisierung durch KI geeignet sind. Der Alltag vieler Berufstätiger hingegen umfasst eine breite Palette von Tätigkeiten, wobei KI nur begrenzt unterstützen kann. Die Relevanz komplexer, manueller oder sozialer Komponenten in der Arbeit erklärt teilweise, warum die Effekte im realen Umfeld geringer ausfallen.
Mit Blick auf die Zukunft bleibt festzuhalten, dass die ökonomischen Auswirkungen von generativer KI noch nicht voll sichtbar geworden sind. Das technologische Tempo ist hoch, und die Innovationskraft in der Entwicklung von KI-Anwendungen wächst beständig. Ebenso erwartet die Wissenschaft, dass sich langfristige Effekte auf Arbeitsmarkt, Lohnverteilung und Unternehmensorganisation erst mit zunehmender Integration und Erfahrung einstellen werden. Nicht zuletzt steht auch die Frage im Raum, wie politische und unternehmerische Rahmenbedingungen gestaltet werden müssen, um den Nutzen der KI fair verteilen zu können. Die Unterstützung von Weiterbildungsprogrammen, Anpassung von Arbeitszeitmodellen und stärkere Mitbestimmung am Arbeitsplatz könnten entscheidend sein, um die Chancen der neuen Technologie gerecht zu nutzen.
Insgesamt zeigt die Studie aus Dänemark, dass die Implementierung von generativer KI in Unternehmen bisher kein schnelles Jobwunder oder radikale Veränderung bewirkt hat. Die durch KI eingesparte Zeit wird häufig durch zusätzliche Aufgaben kompensiert, sodass die Nettoeffekte auf Beschäftigung und Einkommen moderat bleiben. Angesichts dieser Ergebnisse ist eine differenzierte Sichtweise auf die Möglichkeiten und Herausforderungen von KI ratsam, die sowohl Chancen anerkennt als auch die begrenzten Wirkungen bis dato realistisch einordnet. Während Unternehmen und Beschäftigte weiter experimentieren und sich professionalisieren, bleibt die Beobachtung der Entwicklungen ein wichtiger Teil der laufenden gesellschaftlichen Debatte über die Transformation der Arbeitswelt und die Rolle von Künstlicher Intelligenz darin.