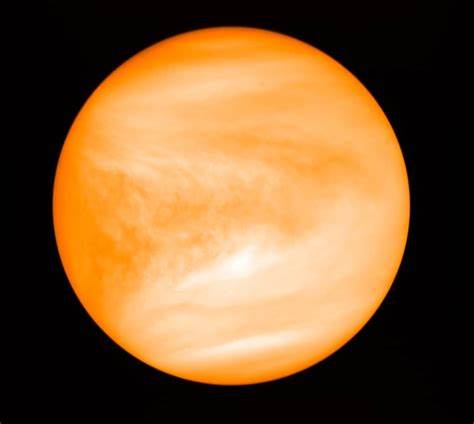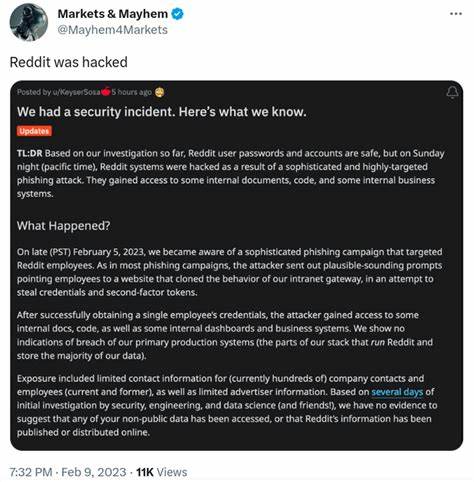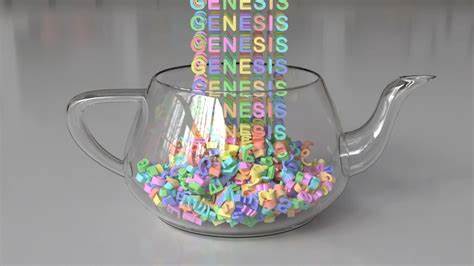Ein Raumfahrzeug aus der sowjetischen Ära, das ursprünglich in den 1970er Jahren für eine Mission zum Planeten Venus konzipiert wurde, steht kurz davor, unkontrolliert zur Erde zurückzukehren. Dieses Raumschiff, bekannt als Kosmos 482, wurde 1972 ins All geschickt, doch ein Raketenfehler verhinderte, dass es seinen Kurs verließ und zur Venus aufbrach. Stattdessen verblieb die Sonde in einem hochelliptischen Orbit um die Erde und hatte seitdem eine bemerkenswerte Reise von über fünf Jahrzehnten. Nun prognostizieren Experten, dass sie um den 10. Mai 2025 in die Erdatmosphäre eintreten wird.
Kosmos 482 wiegt etwa 500 Kilogramm und besteht aus mehreren Komponenten, darunter ein kugelförmiger Landeabschnitt mit einem Durchmesser von circa einem Meter. Dieses Modul wurde eigens dafür konstruiert, die extreme Atmosphäre der Venus zu durchdringen, die vor allem von dichten Kohlendioxid-Schichten geprägt ist. Dieser robuste Aufbau könnte dem Raumfahrzeug helfen, den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu überstehen, weshalb ein größerer Teil des Metallobjekts die Erdoberfläche erreichen könnte. Doch ob das Landemodul tatsächlich intakt bleibt, hängt von mehreren Faktoren ab, beispielsweise dem Zustand des Hitzeschilds nach Jahrzehnten im Weltall und der Funktionsfähigkeit des Fallschirmmechanismus, der wahrscheinlich nicht mehr betriebsbereit ist. Die genaue Stelle, an der Kosmos 482 die Erde berührt, lässt sich derzeit noch nicht vorhersagen.
Die Umlaufbahn des Satelliten hat sich im Verlauf der Jahre allmählich verengt, jedoch bewegt sich das Objekt noch immer zwischen etwa 51,7 Grad nördlicher und südlicher Breite. Somit könnten potenzielle Absturzgebiete von Orten wie London und Edmonton bis zu südlichen Regionen wie Südamerikas Kap Hoorn reichen. Allerdings liegt etwa 70 Prozent der Erdoberfläche unter Wasser, wodurch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Raumschiff im Ozean eintaucht. Das Risiko für die Bevölkerung durch den Wiedereintritt wird von Fachleuten als gering eingeschätzt. Laut dem niederländischen Wissenschaftler Marco Langbroek, der Kosmos 482 beobachtet, entspricht die Gefahr, von Trümmern getroffen zu werden, der eines zufälligen Meteoritenfalls.
Tatsächlich sind Meteoriten, die auf die Erdoberfläche gelangen, keine Seltenheit, und Statistiken belegen, dass das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden, höher ist als durch Teile des Raumschiffs verletzt zu werden. Dennoch schließt man einen Schaden durch die Trümmer nicht vollständig aus, da ein halbes Tonnen schweres Metallstück mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zurückfällt. Technische Experten spekulieren darüber, wie viel von Kosmos 482 die Erdatmosphäre übersteht. Der Hitzeschild, der dazu bestimmt war, extremen Temperaturen und Kräften beim Eintritt in die dichte Venusatmosphäre zu widerstehen, könnte bei der Rückkehr dennoch versagen. Ein Versagen des Schutzschildes würde bedeuten, dass das Objekt größtenteils beim Wiedereintritt verglüht und nur geringe oder keine Überreste auf die Erde fällt.
Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics betont, dass ein intakter Hitzeschild zu einem gefährlichen Szenario werden könnte, da das Raumfahrzeug dann wie ein „halber Tonnen schwerer Metallkörper aus dem Himmel“ fallen würde. Die Geschichte von Kosmos 482 spiegelt die Herausforderungen und Risiken der frühen Raumfahrt wider. Die Mission war Teil einer Reihe von Unternehmungen der Sowjetunion, um den Planeten Venus zu erforschen. Die Venus gehört zu den erdähnlichen Planeten, ist aber aufgrund ihrer dichten Atmosphäre und hohen Oberflächentemperaturen besonders schwer zu erkunden. Die frühen Venusmissionen waren für ihre Zeit technisch sehr anspruchsvoll, und oft endeten sie nicht wie geplant.
Kosmos 482 ist ein Beispiel dafür, wie technische Defekte, wie der hier eingetretene Raketenfehler, den Erfolg einer Mission zunichtemachen können. Der kontrollierte Wiedereintritt von Weltraummüll rückt international immer stärker in den Fokus. Kosmos 482 ist nur eines von zahlreichen Objekten aus der Frühzeit der Raumfahrt, die noch heute die Erdumlaufbahn beeinflussen. Weltraummüll wird zu einem wachsenden Problem, da immer mehr Satelliten und Raumfahrzeuge gestartet werden. Unkontrollierte Wiedereintritte können deshalb potenzielle Gefahren für Menschen und Infrastruktur auf der Erde bergen.
Die internationale Gemeinschaft sucht deshalb nach Lösungen, um künstlichen Weltraummüll zu minimieren, zum Beispiel durch bessere Entsorgungsmaßnahmen und kontrollierte Deorbit-Manöver. In der Vergangenheit gab es bereits spektakuläre unkontrollierte Wiedereintritte. Im Jahr 2018 stürzte die chinesische Raumstation Tiangong-1 erwartungsgemäß über dem Südpazifik ab, nachdem ihre Steuerung verloren gegangen war. Ebenso verursachte 2022 ein chinesischer Raketenbooster, der außer Kontrolle geriet, Diskussionen über die Sicherheit von Weltraummüll und die Notwendigkeit verstärkter internationaler Regulierungen. Im Vergleich zu diesen Ereignissen ist das Risiko von Kosmos 482 zwar überschaubar, dennoch weckt es Interesse und auch ein gewisses Maß an Besorgnis bei Raumfahrtenthusiasten und Experten.
Die noch verbleibende Zeit vor dem erwarteten Wiedereintritt wird von Wissenschaftlern genutzt, um die Flugbahn möglichst genau zu bestimmen. Satellitenüberwachungssysteme, Bodenteleskope und Meteorologen analysieren die Abstiegsparameter, um Abschätzungen für mögliche Einschlaggebiete und -zeiten zu verbessern. Trotz moderner Technik bleibt die präzise Vorhersage von unkontrollierten Wiedereintritten schwierig. Abschließend zeigt das bevorstehende Ereignis rund um Kosmos 482, wie die frühe Raumfahrttechnik bis heute Nachwirkungen zeitigt. Die unkontrollierte Rückkehr eines fast 500 Kilogramm schweren sowjetischen Raumfahrzeugs erinnert daran, dass der Weltraum vor Jahrzehnten bereits intensiv erforscht wurde, einige der damaligen Artefakte aber noch immer im Orbit verweilen.
Während die Wahrscheinlichkeit geringer Schäden für die Menschheit als niedrig gilt, erinnert jeder solcher Vorfälle an den fortbestehenden Bedarf nach verantwortungsbewusstem Management des Weltraumumfelds, um Sicherheit sowohl im All als auch auf der Erde zu gewährleisten.