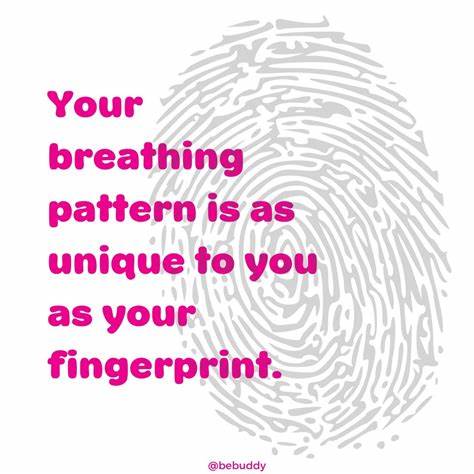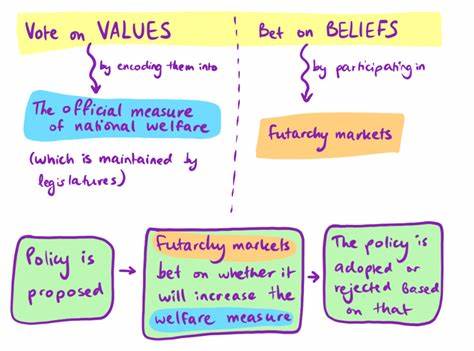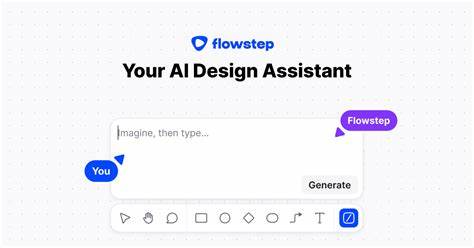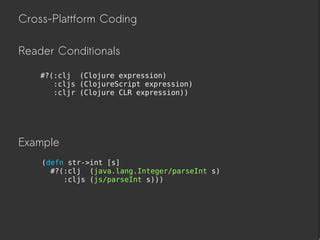In vielen Metropolen weltweit stellt der Ausbau von U-Bahn-Systemen eine zentrale Herausforderung dar – sowohl finanziell als auch planerisch. Die Errichtung neuer Tunnel und Streckenabschnitte ist oft mit enormen Kosten und langwierigen Bauphasen verbunden, was Kommunen und Investoren vor hohe Hürden stellt. Doch es gibt bewährte Konzepte und innovative Ansätze, wie sich Metro-Systeme deutlich preiswerter und zugleich effizienter realisieren lassen. Im Fokus steht dabei die Nutzung bereits vorhandener Netzstrukturen und eine intelligente Verknüpfung der bestehenden Infrastruktur. Wie genau das funktioniert und warum sich dieser Ansatz gerade für Städte mit alten, historischen Bahnnetzen eignet, soll im Folgenden erläutert werden.
Zudem wird beleuchtet, weshalb viele urbane Verkehrsprojekte ihre Potenziale bislang nicht voll ausschöpfen und wie daraus ein zukunftsfähiges, gut vernetztes U-Bahn-System entstehen kann. Der Ursprung vieler großer Städte ist eng mit historischem Eisenbahnbau verbunden, dessen Strukturen bis heute das Verkehrsnetz prägen. Im 19. Jahrhundert entstanden üblicherweise Vorortbahnen, die an Randgebieten der Städte endeten. Es war weder technisch noch ökonomisch einfach, diese Züge tief ins Stadtzentrum fahren zu lassen, weil die Tunnelbau-Technologien noch in den Kinderschuhen steckten und der Flächenbedarf für umfangreiche Bahnhöfe im Stadtinneren enorm war.
Hinzu kamen rechtliche und planerische Restriktionen, die eine umfassende Durchbindung hemmten. Das Resultat: Viele historische Bahnsysteme ähnlichen einem Speichenrad, dessen „Speichen“ im Zentrum einfach enden, ohne sich miteinander zu verbinden. So sind in Städten wie London oder Paris umfangreiche, jedoch von einander isolierte Vorortbahnlinien entstanden, die nebeneinander existieren, jedoch wenig direkte Übergänge bieten. Diese buschfreien Netzmagistralen führt bis heute zu einer eingeschränkten Flexibilität und eingeschränkten Kapazitäten. Zwar entstanden später U-Bahn-Systeme, die tief unter der Stadt mit elektrischen Zügen verkehren können, doch diese ergänzten häufig nur das bestehende Schienennetz, anstatt es grundlegend neu zu denken.
Die Folge ist ein ungleichgewichtiger Mix aus alten und modernen Linien, deren direkte Verbindung selten realisiert wird. Eine Schlüsselinnovation zur Lösung dieses Problems heißt ‚Durchbindung‘ oder ‚Durchlaufbetrieb‘. Dabei werden die bisherigen, an stadtrandlichen Endstationen endenden Vorortlinien miteinander verbunden, häufig über vergleichsweise kurze Tunnelabschnitte im innerstädtischen Bereich. So kann ein Zug, der auf der einen Seite der Stadt startet, ohne Umsteigen direkt auf die andere Seite fahren. Anstatt viele verschiedene Gleisenden zu beseitigen und mit gigantischen neuen Bahnhöfen zu ersetzen, genügt es, ein zentral gelegenes Verbindungsstück neu zu bauen – häufig nur wenige Kilometer lang –, um ein weit verzweigtes Netz miteinander zu verschalten.
Dieses Konzept hat eine bemerkenswerte Kosten-Effizienz zur Folge. Denn während der Tunnelbau teuer ist, sind die historischen Strecken, die schon seit gut hundertfünfzig Jahren bestehen und vielfach schon elektrisch betrieben werden, für das meiste Verkehrspotenzial bereits am Netz selbst vorhanden. So entstehen leistungsfähige Metro-ähnliche Systeme für Bruchteile der Kosten, die ein komplett neues U-Bahn-Netz erfordern würde. Ein renommierter Erfolg dieses Prinzips ist das S-Bahn-System in München. Die Stadt baute in den 1960er Jahren einen rund vier Kilometer langen Tunnel, der verschiedene suburbanen Bahnlinien miteinander verband.
So gelang es, Züge aus entfernten Vororten direkt in das Stadtzentrum zu führen – wo früher ein Umstieg erforderlich war. Das Ergebnis ist heute ein hoch ausgelastetes und effizientes Verkehrssystem, das nahezu die gesamte Metropolregion bedient, mit einer Kapazität von bis zu knapp 49.000 Fahrgästen pro Stunde in jede Richtung. Dabei beschränkten sich die Investitionen in den Tunnel auf einen vergleichsweise kleinen Betrag, verglichen mit dem Nutzen für die ganze Region. Doch München ist keineswegs eine Ausnahme: Ähnliche Projekte gibt es in Berlin, Hamburg, Stuttgart, London und anderen internationalen Großstädten, welche das Prinzip der Durchbindung für Wirtschaftlichkeit und bessere Nutzerfreundlichkeit erkannt haben.
Die Kombination aus bereits verfügbaren oberirdischen Schienen und cleverer Untertunnelung an den neuralgischen Punkten funktioniert wie ein Multiplikator für das ganze Verkehrsnetz. Londons Elizabeth Line ist ein weiteres Beispiel. Sie bietet durch einen etwa 21 Kilometer langen Tunnel eine durchlaufende Verbindung zwischen den bestehenden Eisenbahnstrecken im Osten und Westen der Stadt. Obwohl der Tunnel aufwendig und kostenintensiv war, entspricht die Gesamtstrecke der durchlaufenden Züge mit 117 Kilometern insgesamt einem enormen Wert für die Stadt. Es ermöglicht Vorortbewohnern direkte Verbindungen in die Innenstadt und zu verschiedenen anderen Gegenden Londons, ohne umsteigen zu müssen.
Dies steigert die Attraktivität der Bahn und entlastet gleichzeitig andere überlastete Linien und Bahnhöfe. Neben der reinen Verbesserung des Transportangebots wirkt sich die Vernetzung zudem positiv auf die Stadtentwicklung aus. Bereits heute lässt sich beobachten, dass entlang der durchlaufenden Strecken neue Wohn- und Geschäftsviertel entstehen oder aufgewertet werden. Verkehrsprojekte dieser Art treiben also gleichzeitig eine nachhaltige urbane Verdichtung voran und stellen ein sinnvolles Werkzeug für Städtebau dar. Das steht in starkem Gegensatz zu neuen U-Bahn-Linien, die häufig nur dann wirtschaftlich sind, wenn sie von einer dichten städtischen Bebauung umgeben sind – was nicht immer der Fall ist.
Für viele Städte mit historischen Vorortbahnnetzen ist durchlaufender Bahnverkehr deshalb eine der preiswertesten Maßnahmen für eine umfassende Verkehrsmodernisierung. Insbesondere in Europa und Nordamerika, wo solche Systeme oft seit Generationen bestehen, lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand große Fortschritte erzielen. Im Gegensatz dazu stehen schnell wachsende Städte in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in China, die ohne eine solche historische Bahn-Infrastruktur komplett neue U-Bahn-Netze aufbauen müssen. Diese Arbeiten sind extrem kapitalintensiv und mit großen Projektrisiken verbunden. Dort besteht der Vorteil durchlaufender Netze also noch nicht, weshalb erhebliche Investitionen von Anfang an notwendig sind.
Ein weiteres Beispiel ist das sogenannte ‚Karlsruhe Modell‘, wo das Konzept der Durchbindung noch einmal weitergedacht wurde: Statt reine Züge verkehren hier sogenannte Tram-Trains, die sowohl auf gewöhnlichen Eisenbahnstrecken als auch auf Straßenbahn-Gleisen fahren können. Diese hybriden Fahrzeuge verbinden das Umland mit dem Stadtzentrum auf besonders flexible Weise und ermöglichen es kleineren Städten ebenfalls, von den Vorteilen durchlaufender Verkehrskonzepte zu profitieren. Nicht zuletzt ist zu beachten, dass Durchbindung auch die Bahnhöfe der Innenstadt entlastet. Dadurch, dass Züge nicht mehr an traditionellen Endstationen für längere Pausen halten und wenden müssen, steigt die Kapazität und Zuverlässigkeit des gesamten Netzwerks. Das reduziert Verspätungen, erhöht die Zugfrequenzen und macht den Bahnbetrieb effizienter.
Trotz der vielen Vorteile gibt es auch Hürden. Die Gestaltung der Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Bahnunternehmen oder Betreiberstrukturen ist oft aufwendig und bedarf guter Kooperation. Auch die Finanzierung ist eine Herausforderung, denn die Neubauten müssen mitunter von öffentlichen Haushalten gesichert werden. Dennoch zeigen erfolgreiche Beispiele, dass diese Investitionen sich vielfach rentieren – ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass der Schlüssel zum Ausbau moderner, leistungsfähiger U-Bahn-Systeme nicht zwangsläufig darin liegt, komplett neue Linien und Tunnel kilometerweit zu bauen.