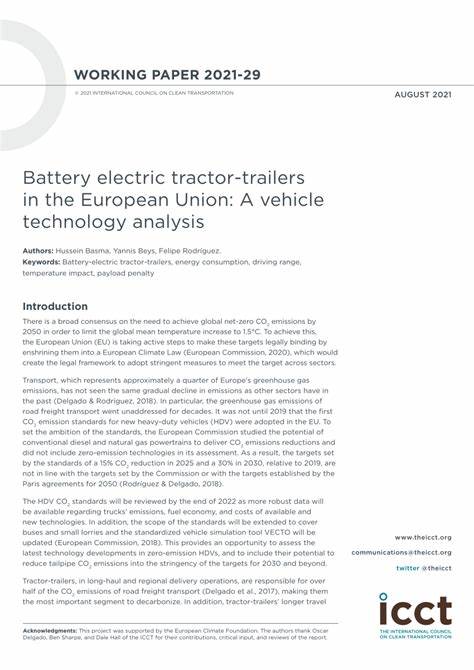Im Zuge der gescheiterten Überzeugungsversuche gegenüber Deutschland und den sogenannten sparsamen Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Notwendigkeit einer angemessenen fiskalischen Union, ist der Rückzugsplatz von Europäischer Rat-Präsident Charles Michel nun die Argumentation für eine Kriegsunion. Europa ist kaum wiederzuerkennen. Verfechter der europäischen Einheit feierten die Europäische Union (EU) einst als ein Friedensprojekt, das eine herrliche Kosmopolitismus gegen den Nationalismus stellte - was, wie der französische Präsident François Mitterrand 1995 dramatisch formulierte, "gleich Krieg" bedeutet. Noch bevor Russland die Ukraine überfiel, begann die europäische Vision einer friedlichen Straße zu gemeinsamem Wohlstand zu verblassen. Russlands Einmarsch beschleunigte nur die Mutation der EU in etwas weit Hässlicheres.
Josep Borrell, der Leiter für Außenbeziehungen der EU, vermittelte uns eine Ahnung des Wandels vom Kosmopolitismus zum ethno-regionalismus, als er die EU als einen schönen "Garten" beschrieb, der von dem außerhalb seiner Grenzen lauernden nicht-europäischen "Dschungel" bedroht wird. In jüngster Zeit forderten der französische Präsident Emmanuel Macron und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, die Europäer nicht nur auf, sich auf Krieg vorzubereiten, sondern entscheidend darauf zu vertrauen, dass die Rüstungsindustrie für das Wirtschaftswachstum und die technologische Entwicklung der EU sorgt. Nachdem sie Deutschland und die so genannten sparsamen Mitgliedsstaaten nicht von der Notwendigkeit einer angemessenen fiskalischen Union überzeugen konnten, ist ihre verzweifelte letzte Hoffnung nun, für eine Kriegsunion zu argumentieren. Dies ist ein entscheidender Moment in der wechselhaften Geschichte der EU. Abgesehen von einer lauten Minderheit von EU-Skeptikern bestand der Hauptunterschied in der Meinung zwischen pro-europäischen politischen Kräften darin, ob die Konsolidierung Europas kontinentweit auf Hamilton'sche Art (Schuldenvergemeinschaftung, die die Entstehung einer angemessenen Föderation beschleunigt) oder auf ursprünglich intergouvernementaler Weise (allmähliche Marktintegration) erfolgen sollte.
Die Regierungen der Überschusswirtschaften bevorzugten letzteres, während die Vertreter der Defizitwirtschaften verständlicherweise zu einer Hamiltonschen Lösung neigten, die daher dauerhaft auf die lange Bank geschoben wurde. Die Eurokrise hat gezeigt, dass es unmöglich ist, vorzugeben, dass Schulden, Banken und Steuern national sind, während die Währung transnational und die Märkte integriert sind. Leider wählte die EU das Minimum, um den Euro zu retten, und landete mit dem Schlimmsten beider Welten: einer grob unzureichenden Quasi-Fiskalunion (ohne angemessenes souveränes Schuldinstrument wie US-Staatsanleihen) und einer Europäischen Zentralbank (EZB), die gezwungen ist, immer wieder gegen ihre Charta zu verstoßen (sich hinter zunehmend kreativen Rechtfertigungen zu verstecken). Am schädlichsten ist vielleicht, dass der wackelige politische Prozess, der gemeinsame Gelder und gemeinsame Lasten verteilt, nicht einmal ein Jota eines Quäntchens demokratischer Legitimität hat. Jahrzehntelang haben einige von uns für einen europäischen Grünen New Deal gekämpft.
Angesichts der Unmöglichkeit einer kurzfristigen Föderation schlugen wir Wege vor, um föderale Schuldinstrumente zu simulieren (wie eine von der EZB ausgegebene Euro-Anleihe), um über die Europäische Investitionsbank (EIB) jährlich mindestens 500 Milliarden Euro für einen Investitionsfonds für grüne Energie-Technologie-Übergänge zu generieren. Stattdessen haben die Entscheidungsträger der EU Rauch-und-Spiegel-Alternativen wie den zum Scheitern verurteilten Juncker-Plan und während der Pandemie einen Erholungsfonds verabschiedet, der gemeinsame Schulden ohne guten gemeinsamen Zweck schuf.