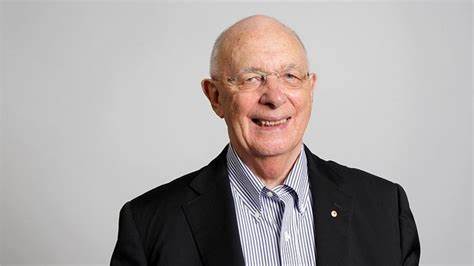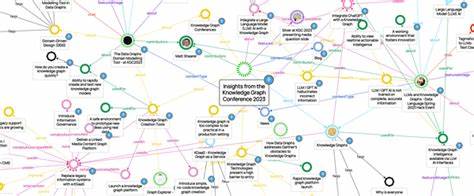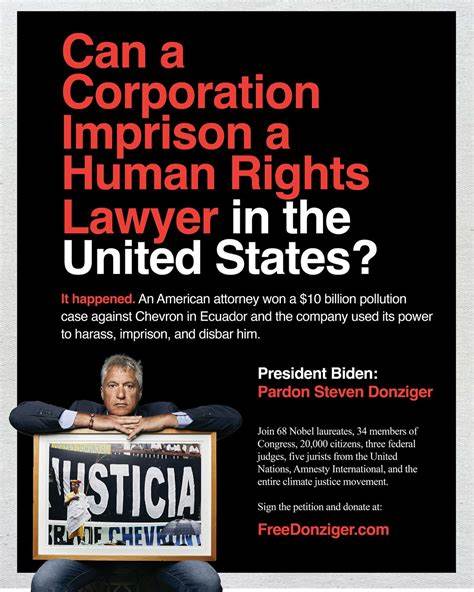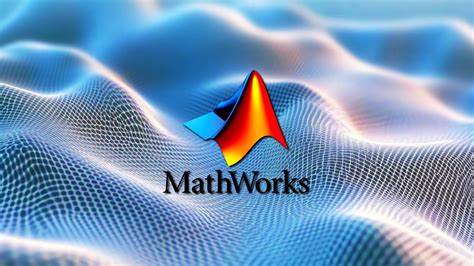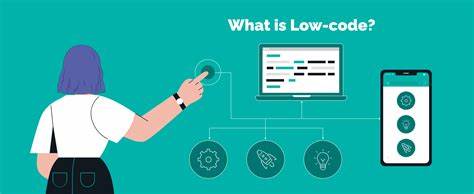Die Vorstellung von der „Entzauberung der Welt“ hat in den letzten Jahrhunderten das Denken über den Modernitätsprozess maßgeblich geprägt. Von Friedrich Schiller über Max Weber bis hin zu zeitgenössischen Philosophen und Soziologen wurde die Geschichte der Moderne oft als Geschichte der Säkularisierung, Rationalisierung und als Ende einer mythischen, magisch durchdrungenen Weltsicht erzählt. Die Idee, dass die Menschen in der Neuzeit die alten Götter, Geister und übernatürlichen Kräfte aus dem Alltag verbannt haben und nun in einer nüchternen, rational berechenbaren Welt leben, galt lange als weitgehend unbestritten. Doch der Essay „We Have Never Been Disenchanted“ von Eugene McCarraher bietet eine provokative Gegenperspektive: Haben wir die Verzauberung der Welt tatsächlich verloren? Oder trägt unsere moderne Gesellschaft ihre eigenen, neuen Formen der Verzauberung in sich – verborgen unter dem scheinbar säkularen Mantel des Kapitalismus? Der historische Hintergrund dieses Diskurses führt in eine Zeit vor und während des Umbruchs, den die protestantische Reformation mit sich brachte. In der vormodernen Welt war die Landschaft mit einem unsichtbaren Universum von Geistern, Göttern und heiligen Wesen bevölkert.
Dieses kosmische Geflecht verlieh dem Leben eine metaphysische Tiefe und Spiritualität, die durch Rituale, Gebete, Omen oder Magie direkt beeinflusst werden konnte. Die mittelalterliche Kirche sammelte viele dieser Aspekte in ihrem System der Heiligen und Sakramente und schuf so eine christlich geprägte Welt des Verzauberten. Doch mit der protestantischen Kritik, besonders aus calvinistischer Sicht, begann eine Abkehr von ‚magischen‘ und sakramentalen Vorstellungen. Die Aufklärung, die Wissenschaft und die industrielle Revolution trugen ihren Teil dazu bei, diesen kosmischen Entzauberungsprozess voranzutreiben, der vom Glauben an rationale Naturgesetze begleitet wurde. Charles Taylor, ein bedeutender Philosoph und Theologe, beschreibt diesen Wandel als Übergang in ein ‚immanentes Rahmenwerk‘.
Der „gepufferte Selbst“ lebt abgekapselt von einer spirituellen Außenwelt, in der die Grenzen zwischen dem Profanen und dem Heiligen scharf gezogen sind. Zwar hat es immer wieder Versuche gegeben, die Welt wieder zu verzaubern, etwa in der Romantik, bei neuen spirituellen Bewegungen oder religiösen Fundamentalismen, doch diese konnten das vorherrschende rationale Weltbild nie ernsthaft gefährden. Doch McCarraher stellt diese Sichtweise infrage: Vielleicht leben wir nicht im Zustand der vollständigen Entzauberung, sondern in einer Welt, in der die alten Götter und Dämonen, so Weber, nicht tot sind, sondern in neuen Formen weiterexistieren. Insbesondere der Kapitalismus könnte als eine moderne Religion mit einer eigenen Metaphysik verstanden werden, die eine Art indirekter Verzauberung darstellt. Die „Gesetze des Marktes“ wirken nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als eine metaphysische Macht, die die Gesellschaft durchdringt und prägt.
Kapitalismus wird hier nicht nur als ein säkulares Wirtschaftssystem gesehen, sondern als die Anzahl der geistigen und moralischen Vorstellungen, die in ihm verwoben sind, und die ihn stützen. Die Idee der „Warenfetischismus“, die Marx ausführlich analysierte, ist hierfür ein zentrales Argument. Marx bemerkte, wie in kapitalistischen Gesellschaften materielle Waren Eigenschaften erhalten, die ihnen nicht objektiv zugeschrieben werden, sondern einer scheinbar magischen Kraft gleichen. So wird der Gebrauchswert einer Ware in ihrer Marktbewertung aufgehoben und verwandelt sich in eine abstrakte Macht, die scheinbar autonom agiert. Dieses Phänomen erinnert an Animismus und Zauberei.
Die Menschen glauben an die Kräfte von Geld und Waren, als seien sie beseelt mit einer übernatürlichen Kraft, obwohl sie Produkte menschlicher Arbeit sind. Dieses Paradox beschreibt eine Verzauberung der materiellen Welt – allerdings in einer säkularisierten Form, bei der auch die Logik der Entfremdung eine Rolle spielt. Kapitalismus, so Marx und McCarraher, ist somit ein modernes, aber ebenso „religiöses“ System mit eigenen Riten, Göttern und Sakramenten, die in Form von Geld und Konsumartikeln erscheinen. Dieses wirtschaftliche System nimmt die Rolle von alten übernatürlichen Mächten ein und erzeugt trotz scheinbarer Rationalität eine metaphysische Dimension, die emotional, moralisch und sozial wirksam ist. Der „Gott Mammon“ wird zur neuen zentralen Gestalt des Glaubens und Versicherers allen gesellschaftlichen Lebens.
Die wachsende Bedeutung von Geld, Konsum und Marktdynamik könnte als zeitgenössische Verzauberung verstanden werden, die unsere Kultur formt. Interessanterweise haben sich starke Kritiken gegenüber diesem kapitalistischen Zauber in der Geschichte vor allem aus dem Geist einer „sakramentalen Imagination“ erhoben. Diese Vorstellung beruht darauf, dass die materielle Welt eine sichtbare Manifestation göttlicher Kraft und Gnade ist und nicht einfach nur als utilitaristisches Objekt betrachtet werden darf. Prominente kulturelle Figuren wie der Romantiker William Blake oder der Sozialkritiker John Ruskin sahen die Übersteigerung von Warenwerten oder die zunehmende Industrialisierung als Entweihung dieser heiligen Dimension. In der industriellen Arbeitswelt und der entmaterialisierten Verhältnislogik des Kapitalismus sehen sie eine profane, lebensfeindliche Entstellung der ursprünglichen sakralen Ordnung.
Ihre Kritik wandelt sich deshalb in eine Forderung nach der Wiedergewinnung von Respekt, Liebe und Staunen gegenüber der Welt der Dinge und des Lebens. Im 20. Jahrhundert griffen zahlreiche Denker diese Tradition auf, um gegen eine technokratische, von Profit und Vernunft dominierte Gesellschaft anzugehen. Dichter wie Allen Ginsberg oder Theologen wie Thomas Merton klagten über die Zerstörung eines „verzauberten“ Weltbildes durch eine alles unterdrückende Logik der Berechnung und Kommerzialisierung. Auf dass gerade mit der Zunahme von Konsum und Markt das Heilige nicht nur verdrängt, sondern systematisch verspottet oder verborgen werde.
Dies wird zunehmend mit dem Begriff „sakramentale Imagination“ beschrieben – die Fähigkeit, im Alltäglichen eine höhere Wirklichkeit zu sehen und wahrzunehmen. Moderne Bewegungen wie etwa die Umweltethik unter Papst Franziskus greifen diese Erkenntnisse auf. In seiner Enzyklika Laudato Si’ beklagt er eine zutiefst vernunft- und machtorientierte Weltsicht, die zur Ausbeutung von Natur und Menschen führt, aber zugleich die innere Verbindung aller Kreatur mit göttlicher Liebe übersieht. Es ist eine Warnung vor einer einseitig profanen Denkweise, die das Heilige als „abgeschafft“ betrachtet, ohne die Spuren seiner immer noch wirksamen Präsenz zu erkennen. Diese Ideen inspirieren zu einem neuen Denken, in dem Kapitalismus nicht einfach als Entzauberung interpretiert wird, sondern als ein Raum, in dem neue Formen „ungesunder Verzauberung“ gehemmt oder transformiert werden können.
Die Romantik hat ebenfalls im 19. Jahrhundert einen Raum eröffnet, in dem ein ästhetisches Gegenbild zur Aufklärung entstand. Dichter und Philosophen priesen Imagination, Enthusiasmus und Inspiriertheit als Quellen einer umfassenderen Sicht, welche die nüchterne Ratio ergänzt. Die romantische Sichtweise erkannte an, dass die Welt nicht nur als Anhäufung von Materie verstanden werden darf, sondern als lebendiger Ausdruck eines transzendenten Wirkens. Im „sakramentalen“ Sehen lag sowohl Kritik am „rein rationalistischen“ Entzauberungsprozess als auch ein Sehnsuchtsort für gesellschaftliche Umkehr.
Beliebt waren dabei Motive, die die Natur, Kunst und das einfache Handwerk als Orte göttlicher Offenbarung gelten ließen. Auf politischer Ebene gab es vielfache Versuche, diesen Geist gegen das entfremdende, technokratische und meist marktorientierte System zu mobilisieren. John Ruskins Kritik der Industriegesellschaft und der Arbeitsteilung ist von einem moralisch-sakramentalen Horizont geprägt, der die Verachtung gegenüber kapitalistischer Entmenschlichung und Güterverwertung ausdrückt. Ähnlich standen jene Vertreter des Sozialismus, die nicht nur materielle Gerechtigkeit, sondern auch kultische und ontologische Dimensionen des Lebens verantworten wollten. Die Befunde McCarrahers verdeutlichen, dass die gängige Vorstellung von einer linearen Entzauberungsgeschichte ihrer Tragweite zum Trotz eine Übervereinfachung sein könnte.
Stattdessen befindet sich die Moderne in einem ambivalenten Zustand, in dem die alte Welt des Zaubers und der Götter zwar ihre klassischen Formen verloren hat, sich diese aber in einem anderen Gewand – etwa durch Marktlogik, Konsumrituale und Kapitalakkumulation – fortsetzen. Diese Deutung fordert eine Neubewertung des Verhältnisses von Rationalität und Mythos, von Wissenschaft und Spiritualität, ja von Wirtschaft und Kultur. Insbesondere der Kapitalismus erscheint somit nicht nur als „kennhafte“ Wirtschaftsordnung, sondern ebenso als eine Art „moderne Religion“, deren eigene „Sakramente“ im Umgang mit Geld, Waren und Konsum zu finden sind. Die Marktgesellschaft verklärt Geld zu einer metaphysischen Macht, der sich der Einzelne unterwirft, während zugleich das Bewusstsein für die ursprüngliche Verbundenheit zwischen Mensch und Schöpfung verloren geht. Diese Perspektive öffnet den Blick dafür, wie tief die alten Bilder noch in der modernen Welt wirken und wie neue Formen von Verzauberung entstehen, bestehen und herausgefordert werden können.
Dieser Ansatz lädt zur kritischen Reflexion ein: Wenn Wirtschaft und Geld verehrt werden wie Götter, welche ethischen und sozialen Konsequenzen hat dies für das Zusammenleben in Gesellschaften? Wie kann die „sakramentale Imagination“ helfen, dem rein instrumentellen Blick etwas anderes, etwas Tiefgründigeres entgegenzusetzen? Vielleicht besteht eine der größten Herausforderungen der Gegenwart darin, diesen verborgenen Zauber der Moderne zu erkennen, sein Irritationspotenzial zu verstehen und eine neue, befreiende Beziehung zur Welt zu entwickeln – eine Beziehung, die Ökonomie, Ökologie und Spiritualität in Einklang bringt. Zusammenfassend zeigt sich, dass der Modernitätsprozess nicht zwingend mit einem Verlust aller Formen von Verzauberung einhergeht. Stattdessen erlebt die Welt eine Verwandlung, in der alte religiöse und magische Elemente in säkulare Erscheinungsformen umschlagen, die nicht minder faszinierend oder wirkungsmächtig sind. Der Kapitalismus etwa erscheint als eine neue, komplexe Form des Glaubens, die unser Verhältnis zu Materie, Geld, Arbeit und letztlich zueinander prägt. Die Wiederentdeckung des Sakramentalen und die kritische Auseinandersetzung mit der „Enchantment“ des Marktes bieten Perspektiven für eine Bewältigung der ökologischen, sozialen und kulturellen Krisen unserer Zeit.
Jeder Schritt hin zu mehr Bewusstsein für diese verborgenen „Zauber“ ist auch ein Schritt weg von ihrer unkontrollierten, entfremdeten Gewalt – hin zu einer Welt, in der das Heilige inmitten des Profanen neu entstehen kann.