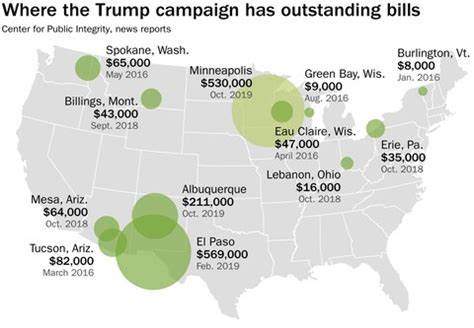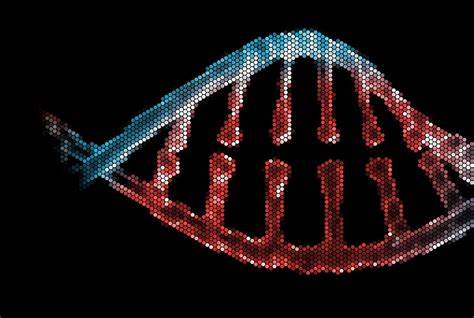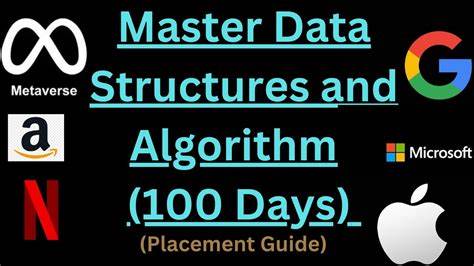Der Large Hadron Collider (LHC) am CERN gilt als eines der technologisch beeindruckendsten und komplexesten Forschungsanlagen weltweit. Seine Hauptaufgabe ist die Beschleunigung und Kollision von Protonen mit extrem hohen Energien, um grundlegende Fragen der Physik zu erforschen. Trotz dieser enormen Leistungen stellt der Umgang mit der beträchtlichen Energiemenge eine gewaltige technische Herausforderung dar – insbesondere wenn es um den sicheren Abbau von Teilchenstrahlen geht. In diesem Zusammenhang spielt der sogenannte Strahlabsorber oder Beam Dump eine zentrale Rolle. Die jüngst durchgeführte Autopsie eines radioaktiven LHC-Strahlabsorbers gewährt erstmals detaillierte Einblicke, wie die Materialien im Inneren dieses komplexen Bauteils auf die enorme Belastung durch hochenergetische Teilchenstrahlen reagieren und welche Schlüsse daraus für zukünftige Entwicklungen gezogen werden können.
Die Aufgabe eines Beam Dumps besteht darin, hochenergetische Protonenstrahlen nach ihren Einsätzen kontrolliert und sicher zu stoppen. Dabei müssen diese Umwandlungen in thermische Energie sowie die damit verbundenen physikalischen Belastungen präzise beherrscht werden, um Gefährdungen für die Anlage, Umwelt und Personen zu vermeiden. Der Strahlabsorber des LHC ist ein aus mehreren Komponenten zusammengesetztes, mehrere Tonnen schweres Konstrukt mit komplexen Materialien wie hoch- und niedrigdichtem Graphit, eingebettet in ein stabiles Gehäuse aus hochlegiertem Edelstahl. Seine Dimensionen und Materialwahl sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Optimierung, die einerseits maximale Absorptionsleistung gewährleisten und andererseits Haltbarkeit gegen die intensive Beanspruchung sicherstellen sollen.Nach zehnjährigem Betrieb wurden die beiden externen LHC-Strahlabsorber während der zweiten Long Shutdown-Phase (LS2) entfernt und durch überarbeitete Ersatzgeräte ausgetauscht.
Grund dafür waren alterungsbedingte Materialschäden, insbesondere Lecks von Stickstoff. Bereits im Jahr 2020 wurde mittels Endoskopie eine erste Schadensanalyse an den Graphitkomponenten vorgenommen. Dabei fanden die Experten unerwartete Risse in den extrudierten Graphitscheiben, die den Stapel aus niedrigdichtem Graphit zusammenhalten. Dieses Ergebnis nötigte zu einer vertieften Untersuchung der Ursachen und einer Prüfung der Tauglichkeit der verschiedenen Graphitmaterialien unter extremen Betriebsbedingungen.Die Entscheidung fiel schließlich auf eine sogenannte Autopsie, bei der der Strahlabsorber physisch geöffnet und sein Inneres eingehend untersucht wird.
Aufgrund der Radioaktivität des Bauteils war das allerdings mit erheblichen technischen und organisatorischen Herausforderungen verbunden. Das mit einem Duplex-Edelstahlgehäuse umschlossene Gerät lässt sich nicht ohne weiteres öffnen, zumal eine manuelle Bearbeitung nicht nur viel Zeit erfordert hätte, sondern auch die zulässige Strahlenbelastung für das Personal überschritten hätte. Die Möglichkeit, diese Aufgabe an externe Spezialfirmen zu vergeben, war aufgrund von Kosten und Zeitplänen ebenfalls ausgeschlossen.An dieser Stelle zeigten sich die Stärken der internen Expertise des CERN. Die Teams der Forschungsgruppe Sources, Targets and Interactions (SY-STI) arbeiteten eng mit den Spezialisten der Abteilung für Steuerung, Elektronik und Mechatronik (BE-CEM) zusammen, um zwei innovative, fernsteuerbare Schneidtechnologien zu entwickeln.
Eine automatisierte Kreissäge auf einer Schienenführung und ein Roboterarm mit passendem Schneidewerkzeug wurden speziell auf den Präzisionsschnitt am strahlenbelasteten Edelstahlgehäuse ausgelegt. Intensive Testläufe an Modellen ermöglichten eine präzise Planung und Durchführung, damit die Gesundheit der am Arbeitsplatz befindlichen Mitarbeiter nicht gefährdet wurde und die Schneidzeiten minimal blieben.Durch diese sorgfältige Vorgehensweise konnten schließlich fünf Schnitte an dem Behälter ausgeführt werden, um das Gehäuse zu entfernen und die darin verborgenen Graphitkomponenten freizulegen. Die anschließende Untersuchung bestätigte die Schäden an den extrudierten Graphitscheiben, doch überraschenderweise zeigten die niedrig- und hochdichten Graphitblöcke kaum Spuren von Materialermüdung oder Rissbildung. Diese Erkenntnis beeinflusst maßgeblich die Zukunft der Konstruktion und Auswahl der Materialien für bestehende und künftige Strahlabsorber, insbesondere für den geplanten High-Luminosity LHC (HL-LHC), der unter noch höheren Belastungen betrieben wird.
Die Validierung der Materialbeständigkeit der Bestandteile für die laufende Betriebsphase Run 3 schafft Vertrauen, dass die nun eingesetzten und modifizierten Beam Dumps den momentanen Anforderungen gerecht werden. Gleichzeitig hat man sich mit dem Ausschluss der extrudierten Graphitkomponenten als kritisch für die Lebensdauer eines Beam Dumps auf einen neuen Entwicklungsweg für Ersatzteile und Neuentwicklungen eingestellt. Aktuelle Tests im HiRadMat-Experimentatorium werden durch weitere Analysen ergänzt, um neuartige Materialien und Bauweisen zu erproben, die zukünftig effektiveren Schutz vor Materialerschöpfung und Leckagen bieten können.Die Autopsie des LHC-Strahlabsorbers zeigt exemplarisch, wie wichtig kontinuierliche Wartung, sorgfältige Materialuntersuchung und innovative Lösungen im Operationsteam sind, um den Betrieb einer der weltweit anspruchsvollsten wissenschaftlichen Anlagen langfristig sicher und effizient zu gewährleisten. Die gewonnenen Daten fließen nicht nur in die Optimierung der aktuellen Komponenten ein, sondern bilden auch die Basis für neue Entwicklungen im Rahmen der Hochlumositätsphase des LHC, in der die Strahlenergien und -intensitäten nochmals massiv gesteigert werden sollen.
Dabei stehen nicht nur technische und sicherheitsrelevante Aspekte im Vordergrund, sondern auch die nachhaltige Gestaltung der Infrastruktur. Die langjährigen Belastungen durch Strahlung und thermischen Stress erfordern Materialien, die möglichst widerstandsfähig sind, aber auch recyclebar und umweltverträglich. Die Zusammenarbeit zahlreicher Teams unterschiedlicher Fachrichtungen bei CERN, von Werkstoffwissenschaftlern über Mechanik- bis zu Strahlenschutzexperten, sorgt für eine ganzheitliche Betrachtung und die stetige Weiterentwicklung der Betriebssicherheit.Nicht zuletzt verdeutlicht diese Untersuchung den hohen Stellenwert, den präzise Diagnosen und innovative Eingriffe bei der Wartung und Instandhaltung radioaktiver Komponenten haben. Der sichere Betrieb derartigen High-Tech-Anlagen ist nur durch ein ausgewogenes Verhältnis von Forschung, praktischer Erfahrung und technologischer Innovationskraft möglich.
Die Autopsie eines Beam Dumps beim LHC setzt in diesem Bereich Maßstäbe und gibt wertvolle Impulse für kommende Projekte und deren Herausforderungen.Das Zusammenspiel von präziser Materialforschung, ausgeklügeltem Engineering und strenger Einhaltung von Sicherheitsvorschriften sichert die Effektivität des LHC bei gleichzeitiger Minimierung von Risiken. Dadurch schafft CERN ein solides Fundament für die Zukunft der Teilchenphysik und bleibt Vorreiter bei der Konstruktion und dem Betrieb hochkomplexer Beschleunigeranlagen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Autopsie des Strahlabsorbers werden weit über die Grenzen der Anlage hinaus Wirkung entfalten – seien es die Weiterentwicklung innovativer Materialien oder die Etablierung neuer Standards im Management von radioaktiven Bauteilen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die „Autopsy of an LHC Beam Dump“ ein essenzieller Schritt zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit und Leistungssteigerung am Large Hadron Collider ist.
Die technischen Herausforderungen bei der Öffnung und Untersuchung eines hochradioaktiven, robusten Bauteils konnten mit intelligenten, teamübergreifenden Lösungsansätzen bewältigt werden, was beispielhaft für zukünftige Wartungs- und Instandhaltungsstrategien an ähnlichen Anlagen dienen kann. Die daraus gewonnenen Einsichten helfen nicht nur, vorhandene Defizite zu beheben, sondern auch die Entwicklung leistungsfähigerer und sichererer Instrumente der Grundforschung zu fördern – ein bedeutender Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung des gesamten Forschungsfeldes.