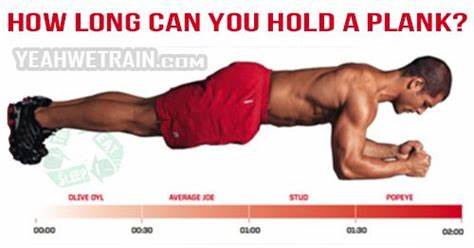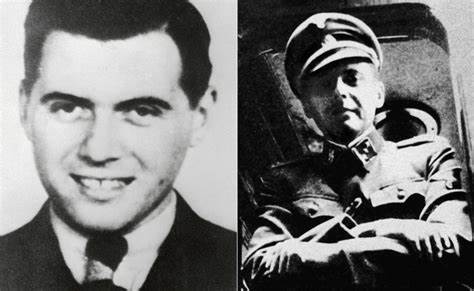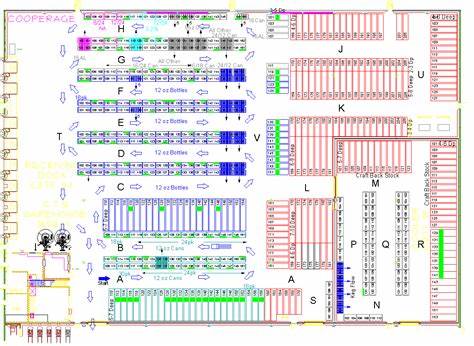Die Räume über unseren Köpfen sind zunehmend Schauplatz bahnbrechender Innovationen, die nicht nur den Weg nach oben, sondern auch den Weg zurück zur Erde revolutionieren. Inmitten dieser aufregenden Entwicklungen spielt die europäische Firma Atmos Space Cargo eine entscheidende Rolle, indem sie den Rücktransport von Raumfahrt-Nutzlasten mit einer neuen Generation von Wiedereintrittskapseln, aufgebaut auf einem innovativen aufblasbaren Hitzeschild, neu definiert. Diese Technologie birgt nicht nur das Potenzial, Europas Eigenständigkeit im Bereich Orbitallogistik zu stärken, sondern stellt auch einen wichtigen Schritt hin zu nachhaltigeren und wiederverwertbaren Raumfahrzeugen dar. Atmos Space Cargo wurde mit der Vision gegründet, die Herausforderungen der Rückführung von Forschungs- und Produktionsgütern aus dem All kostengünstig und zuverlässig zu meistern. Während Raketenstarts und Satellitenstarts oft im Fokus stehen, rückt der sichere und effiziente Wiedereintritt zurück zur Erde mehr und mehr ins Blickfeld von Wissenschaftlern und Unternehmen.
Die steigende Anzahl an Forschungsmissionen auf der Internationalen Raumstation (ISS), biomedizinischen Experimenten und zukünftigen orbitalen Produktionsstätten erfordert eine neue Form der Logistik. Atmos Space Cargo hat sich dieser Aufgabe angenommen und baut auf Grundlage der NASA-Technologie des aufblasbaren Hitzeschilds auf. Dieses Konzept wurde bereits von der NASA mit ihrem Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) erfolgreich getestet und weiterentwickelt. Das Prunkstück der Atmos-Technologie ist der aufblasbare Hitzeschild, der sich entscheidend von herkömmlichen starren Aeroshell-Schildern unterscheidet. Bei der Wiedereintrittsphase, die die Konstruktion und Zuverlässigkeit von Raumfahrzeugen besonders herausfordert, entfaltet sich der Hitzeschild wie ein Kissen, dessen Oberfläche durch das Einfangen und Nutzen der heißen, energiereichen Luftschicht zwischen der Kapsel und dem atmosphärischen Schock vor dem Fahrzeug aufgeblasen und stabilisiert wird.
Dieses Verfahren ist nicht nur leicht und kompakt zu transportieren, sondern verringert auch maßgeblich die Belastung und den Verschleiß der Kapsel während des temperierten Wiedereintritts in die Erdatmosphäre. Die erste Demonstration der Wiedereintrittskapsel namens Phoenix 1 wurde bereits im April 2025 als Teil der SpaceX-Bandwagon-3-Mission durchgeführt. Die kleine und kompakte Kapsel, die lediglich 250 Kilogramm wog und für einen Rideshare-Slot auf einer Falcon 9 konzipiert wurde, bewies eindrucksvoll, dass die Rückführung von Nutzlasten auf kostengünstige Weise möglich ist. Dabei profitierte Atmos von einer Kooperation mit SpaceX, welche die Kapsel in eine passende Umlaufbahn brachte, ohne dass Atmos eine eigene Antriebseinheit an Bord bringen musste. Phoenix 1 wurde rund 90 Minuten nach dem Start ausgesetzt, trat in die Atmosphäre ein und landete schließlich im Südatlantik.
Diese Mission bedeutete viel mehr als nur einen technischen Erfolg: Atmos und sein Team mussten Blitz-Reaktionslösungen erarbeiten, um auf eine unerwartete Änderung der Landestelle zu reagieren. Dabei kamen unter anderem Amateurfunkstationen aus Südamerika zum Einsatz, um Telemetriedaten von der Kapsel zu empfangen und zu verfolgen. Die gesammelten über 135.000 Telemetriepunkte konnten wertvolle Einblicke in die Dynamik der Kapsel während Wiedereintritt und Landung liefern und zeigen deutlich, wie moderne Netzwerke und die Gemeinschaft Raumfahrtinnovationen unterstützen können. Ein herausragendes Merkmal von Phoenix und Atmos’ Vision ist die vollständige Wiederverwendbarkeit der Kapsel.
Während herkömmliche Maschinen nach der Rückkehr oft nur die eigentliche Nutzlastkapsel bergen und der Service- oder Antriebsteil im Orbit verbleibt, strebt Atmos danach, alle Komponenten inklusive Solarzellen, Avionik und Antriebssysteme zurückzuholen. Für die nächste Version, Phoenix 2, ist ein eigenes grünes Antriebssystem vorgesehen, das mit ungiftigen Treibstoffen wie Ethan und Distickstoffmonoxid arbeitet. Dieses Design trägt sowohl zu mehr Nachhaltigkeit als auch zu einem vereinfachten Betrieb bei, da strenge Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung toxischer Treibstoffe entfallen können. Die Fähigkeit, den Wiedereintritt bis zum Wasserpräzisions-Landeort aktiv und kontrolliert zu steuern, ist ein weiterer innovativer Fortschritt. Phoenix unterscheidet sich zu klassischen Modellen, die nach dem Absprengen vom Service-Modul mit Fallschirmen absteigen und vom Wind getrieben werden.
Die Aerodynamik der Kapsel mit ihrem asymmetrischen, donutförmigen Design erzeugt während des Abstiegs einen Auftrieb, der durch Klappen und kleine Rolltriebwerke gezielt gesteuert wird. So lassen sich die Reentry-Phasen dirigieren, um Landungen mit einer unerreichten Treffgenauigkeit von weniger als 100 Metern zu ermöglichen. Dieses Präzisionslandeverhalten erlaubt es, sowohl mittlere als auch sensible Nutzlasten sicher zurück auf die Erde zu bringen und eröffnet neue Möglichkeiten in der Logistik von Raumfahrtgütern. Der Fokus von Atmos geht weit über wissenschaftliche Experimente hinaus. Die Kapsel wurde so konzipiert, dass sie das Standardmaß von „Mid-Deck Lockers“ der ISS transportieren kann – gängige Container für Forschungsgeräte, die zum Beispiel für Biowissenschaften, Materialforschung oder medizinische Anwendungen entwickelt wurden.
Dabei bietet die Kapsel rund 100 Kilogramm Nutzlastkapazität und 100 Watt elektrische Leistung, um anspruchsvolle Systeme mit Energie und Datenanschluss zu versorgen. Die Automation der Kapsel und die fernsteuerbaren Systeme ermöglichen zudem, dass sich die komplette Mission von der Erdoberfläche aus kontrollieren lässt, wodurch Betriebstoleranz und Sicherheit weiter gesteigert werden. Die Strategie von Atmos Space Cargo umfasst auch eine breite Kompatibilität mit diversen Trägerraketen, was den Zugang zum Markt erleichtert. Neben SpaceX und der Falcon-9-Flotte plant das Unternehmen, seine Kapseln auch mit europäischen und internationalen Trägern wie Ariane 6, Vega, New Glenn oder kleineren Systemen wie Electron und Spectrum zu starten. Die Kapsel ist auf der 24-Zoll-ESPA-Ring-Adapterplatte aufgebaut, die üblicherweise für sekundäre Nutzlasten bei kommerziellen Starts verwendet wird.
Diese Launcher-Neutralität ermöglicht eine flexible Einsatzplanung und attraktivere Preisgestaltung. Langfristige Perspektiven sind für Atmos äußerst ambitioniert. Neben der baldigen Mission nach Santa Maria in der Azorenregion, bei der Phoenix 2 erstmals auf europäischem Boden landen wird, arbeitet das Unternehmen an größeren Modellen wie Phoenix 3. Diese skalierbare Fahrzeugreihe kann die Nutzlastkapazität deutlich auf bis zu eine Tonne oder in der Zukunft bis zu 25 Tonnen steigern. Ein solcher Entwicklungsschritt könnte den Transport ganzer Containereinheiten aus dem Orbit möglich machen – ein Szenario, das weitreichende Folgen für die Raumfahrtlogistik und den globalen Materialtransfer aus dem Weltraum hätte.
Zusätzlich wird die Technologie von Atmos für militärische Anwendungen evaluiert, beispielsweise für schnelle Rückführung von sensiblem Equipment, sowie für die Rückführung von Aufstiegsstufen von Raketen. Im Rahmen des ICARUS-Projekts der Europäischen Kommission wird die Technologie für das sichere Reentering und die Wiederverwendung von Oberstufen weiterentwickelt und könnte so künftig beachtliche Kosten- und Umwelteinsparungen ermöglichen. Ein weiterer Ausblick liegt in der Verbindung von Atmos’ Wiedereintrittskapseln mit fortschrittlichen Satelliten-Servicing-Technologien, mit denen defekte oder veraltete Geräte eingefangen und kontrolliert zurück zur Erde gebracht werden könnten. Dies bietet eine nachhaltige Lösung für das wachsende Problem des Weltraummülls und könnte neue Wege für Reparaturmissionen und Satellitenwiederverwendung eröffnen. Atmos Space Cargo zeigt eindrucksvoll, dass Europas Raumfahrtindustrie in puncto Innovation und Marktfähigkeit eine führende Rolle einnehmen kann.




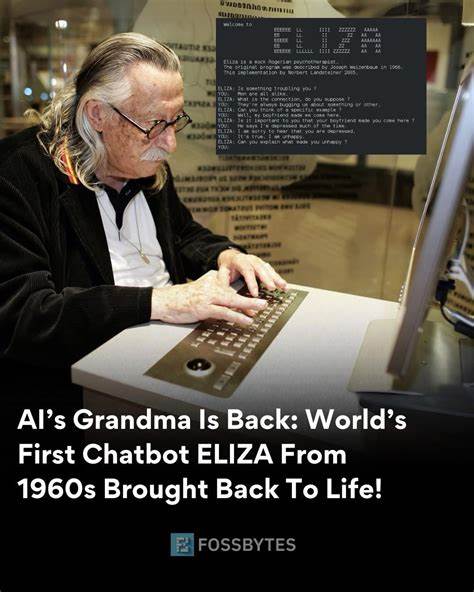
![AI Scheduling for Teams [video]](/images/7D96833B-2E14-47FD-916C-89025B868A60)