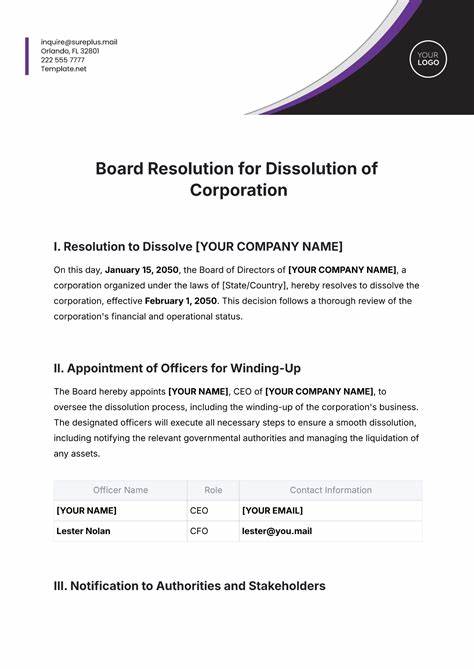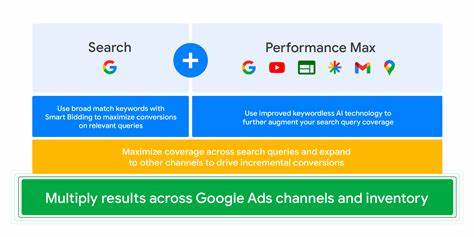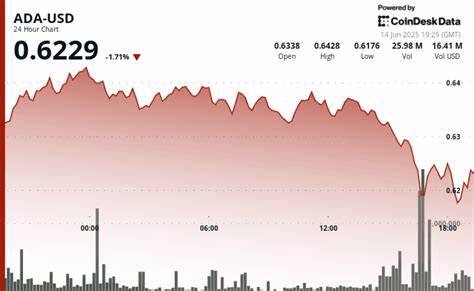Die Aufforstung von Wäldern gilt als eine der wichtigsten natürlichen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Bäume nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und speichern Kohlenstoff im Holz und Boden. Dabei wird das Prinzip verfolgt, den Anstieg von Treibhausgasen zu bremsen und langfristig sogar zu senken – ein Grundpfeiler vieler Strategien zur Klimafolgenminderung weltweit. Doch die Klimawirkung von Baumpflanzungen ist komplexer als allein die Bindung von Kohlendioxid, da auch weitere atmosphärische Prozesse und Wechselwirkungen eine Rolle spielen. Die neueste Forschung zeigt, dass die atmosphärische Chemie diese Prozesse deutlich beeinflusst und somit das Potenzial von Aufforstung zu einem wirksameren Klimaschutzhebel macht als bisher angenommen.
Traditionell wurde die Wirksamkeit von Aufforstung vor allem anhand der Kohlenstoffaufnahme beurteilt. Je mehr CO2 ein Wald speichert, desto größer die vermeintliche Klimawirkung. Doch in den letzten Jahren haben Wissenschaftler festgestellt, dass neben dieser biogeochemischen Wirkung auch biogeophysikalische Faktoren Einfluss nehmen. Diese umfassen etwa Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit wie der Albedo, also der Rückstrahlfähigkeit der Erdoberfläche, sowie Effekte auf Temperatur, Wasserhaushalt und Evapotranspiration. Wälder absorbieren durch ihre dunkle Blattfärbung mehr Sonnenstrahlung, was zu einer regionalen Erwärmung führen kann.
Andererseits erweitern sie durch Verdunstung die Wasserabgabe in die Atmosphäre, was wiederum kühlend wirken kann. Solche Effekte mindern oder verstärken die direkte Klimawirkung durch Kohlenstoffbindung – eine wichtige Nuance, die es zu verstehen gilt, um Aufforstung richtig zu bewerten. Neuere Studien, die modernste Klimamodelle mit interaktiver atmosphärischer Chemie verwenden, haben nun einen weiteren bedeutenden Faktor herausgearbeitet: die Rolle der biogenen flüchtigen organischen Verbindungen, die Bäume in die Luft abgeben. Diese sogenannten BVOCs wie Isopren und Monoterpene reagieren in der Atmosphäre chemisch, bilden sekundäre organische Aerosole (SOA) und beeinflussen Wolkenbildung und deren Eigenschaften. Aerosole wirken als Kondensationskeime für Wolkentröpfchen und verändern so die Wolkendichte und -reflexion.
Das führt zu einer erhöhten Albedo der Wolken, welche die Sonneneinstrahlung abschwächt und damit eine kühlende Wirkung entfaltet. Insbesondere in tropischen Regionen, wo das Baumwachstum und BVOC-Emissionen am stärksten sind, verstärken diese Prozesse die Klimawirkung der Aufforstung spürbar. Während die biogeophysikalischen Effekte in hohen Breiten oft eine Erwärmung durch verringerte Albedo bewirken, wird in den Tropen dank erhöhter Verdunstung und verstärktem Aerosol- und Wolkenaufbau eine Kühlung beobachtet. Dadurch steigt nicht nur die Effizienz der CO2-Speicherung, sondern es entstehen zusätzliche, indirekte Klimaschutzeffekte. Die Forschung beruht auf Simulationen mit dem Community Atmosphere Model (CAM6) in Kombination mit Land- und Ozeanmodellen, die ein hochrangiges Baumpflanzungsszenario durchspielen.
Dabei wurde das Szenario mit und ohne Berücksichtigung der komplexen atmosphärischen Chemie simuliert. Die Ergebnisse zeigten, dass die globale Durchschnittstemperatur durch Aufforstung zunächst steigt, wenn nur biogeophysikalische Effekte ohne chemische Rückkopplungen betrachtet werden. Das liegt maßgeblich an der Oberflächenverdunklung durch Bäume, besonders in borealen und gemäßigten Zonen. Sobald jedoch die interaktive Chemie einbezogen wird, sinkt die Erwärmung deutlich ab und kann sogar eine leichte Abkühlung bewirken, vor allem in der Südhemisphäre. Verantwortlich dafür sind vermehrt gebildete organische Aerosole und Wolken, die das Sonnenlicht stärker reflektieren.
Dieses Phänomen hat weitreichende Folgen für die Einschätzung des Klimaschutzpotenzials von Baumpflanzungen. Ohne Berücksichtigung der atmosphärischen Chemistry wirken biogeophysikalische Effekte sogenannte negative Rückkopplungen, die fast die Hälfte der positiven Wirkung durch CO2-Aufnahme neutralisieren. Mit der Berücksichtigung der chemischen Vorgänge reduziert sich dieser dämpfende Effekt auf etwa ein Viertel. Insgesamt wird dadurch der Netto-Nutzen von Aufforstung für den Klimawandel größer, als bisher häufig angenommen. Weiterhin zeigten die Studien, dass die atmosphärische Chemie neben den Aerosolen auch andere Kurzlebige Klimaschadstoffe (SLCFs) wie Methan und Ozon beeinflusst.
Durch die vermehrten BVOC-Emissionen sinkt die Konzentration von Hydroxylradikalen, was wiederum die Lebensdauer von Methan verlängert und dessen Konzentration steigen lässt. Methan hat selbst eine starke Erwärmungswirkung, sodass hier ein leicht gegensteuernder Effekt auftritt. Allerdings ist diese Erwärmung relativ klein und überlagert nicht die durch Aerosole und Wolken ausgelöste Kühlung. Aufforstung beeinflusst ebenfalls die Feueraktivität. Feueremissionen nehmen in tropischen Gebieten ab, da durch die Pflanzung von Bäumen mehr Feuchtigkeit gespeichert wird und die Vegetation weniger trocken ist.
In den gemäßigten Zonen jedoch können Feuer leichter zunehmen, da unbewaldete Flächen von Bäumen ersetzt werden, welche höhere Temperaturen hervorrufen. Doch auch hier mildert die atmosphärische Chemie die Feuerzunahme durch ihre kühlenden Effekte. Nicht zuletzt verändern Baumpflanzungen auch den Stickstoffkreislauf. Die verbesserte Landschaftsrauhigkeit führt zu höheren Depositionen von atmosphärischem Stickstoff, was wiederum das Pflanzenwachstum fördert. Dieser Effekt trägt zusätzlich zur Kohlenstoffspeicherung bei und wird erst mit integrierter Chemie simuliert.
Die Mehrzahl der existierenden Klimamodelle berücksichtigt diese komplexen Wechselwirkungen nicht vollständig. Insbesondere die Interaktivität von BVOCs, Aerosolen und Wolken sowie deren Effekte auf Temperatur und Feuchtigkeit werden oft vernachlässigt. Die neue Forschung hebt hervor, wie wichtig die Einbeziehung atmosphärischer Chemie ist, um verlässliche Vorhersagen zum Einfluss von Aufforstungsmaßnahmen auf das globale Klima zu treffen. Aus der Perspektive von Klimapolitik und Naturschutz dürften diese Erkenntnisse die Bedeutung großflächiger natürlicher Klimaschutzmaßnahmen stärken. Viele Initiativen verfolgen ambitionierte Ziele, um Wälder weltweit wiederherzustellen.
Die Erkenntnis, dass atmosphärische chemische Prozesse diesen Effekt verstärken können, liefert zusätzliche Argumente für Investitionen in solche Programme, insbesondere in tropischen Regionen. Gleichzeitig muss jedoch bedacht werden, dass verstärkte BVOC-Emissionen lokal auch Luftqualitätsprobleme verschärfen können, beispielsweise durch erhöhte Ozonbildung. Eine ganzheitliche Betrachtung und weiteres Monitoring bleiben daher unerlässlich. Langfristig ist davon auszugehen, dass ein besseres Verständnis der atmosphärischen Chemie es ermöglicht, gezieltere Aufforstungsstrategien zu entwickeln. So kann die Wahl der Baumarten und deren geografische Platzierung optimiert werden, um sowohl CO2-Bindung als auch klimatische Nebeneffekte bestmöglich zu nutzen.