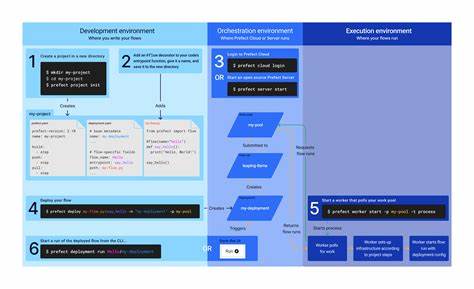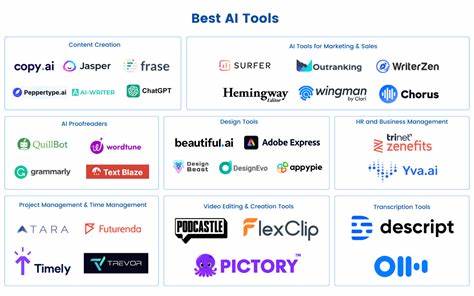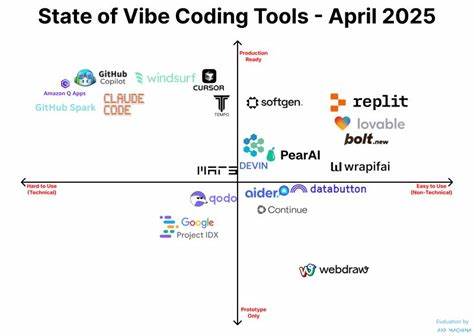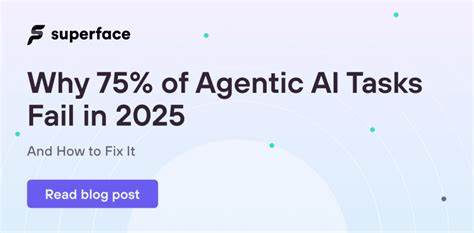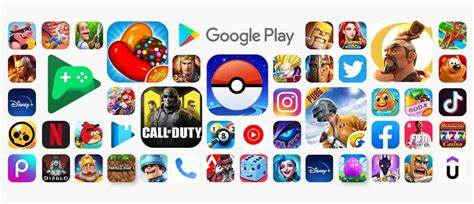In den vergangenen Jahren hat Europa einen beispiellosen Anstieg an industriellen Tierhaltungsanlagen, sogenannten Megabetrieben oder Factory Farms, erlebt. Mehr als 24.000 dieser Großanlagen sind auf dem gesamten Kontinent entstanden und stehen beispielhaft für eine landwirtschaftliche Entwicklung, die tiefgreifende Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Tierwohl mit sich bringt. Diese Entwicklung ist geprägt von der Übernahme amerikanischer Modelle der Intensivtierhaltung und steht im Zentrum aktueller Debatten über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ernährungssicherheit. Die Intensivtierhaltung ist definiert als die Haltung von großen Tiergruppen auf engem Raum mit dem Ziel, möglichst hohe Produktionszahlen zu erzielen.
In Europa gelten Tierhaltungen als intensiv, wenn auf einem Betrieb gleichzeitig 40.000 oder mehr Geflügeltiere, 2.000 oder mehr Mastschweine oder 750 oder mehr Zuchtsauen gehalten werden. Besonders in Ländern wie Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Italien und Polen sind diese Megabetriebe stark verbreitet. So beherbergt Frankreich europaweit die größte Anzahl an intensiven Geflügelhaltungsanlagen, gefolgt vom Vereinigten Königreich.
Die Ursachen für den Boom der Megabetriebe liegen in der wirtschaftlichen Logik der Landwirtschaft. Große Tierhaltungsanlagen profitieren von Skaleneffekten, die es ermöglichen, die Produktivität pro Tier zu erhöhen und gleichzeitig Produktionskosten zu senken. Vor allem im Bereich von Schweinen und Geflügel zeigt sich ein deutlicher Trend zur Industrialisierung, während kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe sowohl in Anzahl als auch wirtschaftlicher Bedeutung deutlich zurückgehen. Dieser Wandel bringt jedoch erhebliche ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen mit sich. Ein zentrales Problem der Factory Farms ist die hohe Umweltbelastung, die von ihnen ausgeht.
Insbesondere intensive Geflügelhaltungen verursachen durch ihre großen Mengen an Tierkot eine massive Überdüngung von Boden und Gewässern. Phosphate aus Geflügelmist gelangen in Flüsse und Seen und führen zu einer Sauerstoffverarmung in diesen Gewässern, was das Überleben von Fischen und Pflanzen gefährdet. Flüsse wie die Severn und Wye in Großbritannien gelten als Hotspots der intensiven Geflügelhaltung, mit beispielsweise 79 Hühnern pro Einwohner in der Region. Die Folgen sind gravierende Beeinträchtigungen der Wasserqualität und zunehmende ökologische Schäden. Neben der Gewässerverschmutzung gibt es auch erhebliche Probleme mit der Luftreinhaltung und der Überdüngung durch ausgelaufene oder schlecht gepflegte Güllebehälter.
In Großbritannien wurden seit 2015 nahezu 7.000 Verstöße gegen Umweltvorschriften durch Megabetriebe registriert. Viele dieser Verstöße betreffen Undichtigkeiten von Güllegruben, welche Nährstoffe und Schadstoffe in die Umwelt freisetzen, sowie Luftverschmutzung durch Ammoniakemissionen und Geruchsbelästigung. Trotz der Häufigkeit und Schwere der Verstöße fällt die rechtliche Verfolgung der Unternehmen vergleichsweise schwach aus, wodurch das Vertrauen in den Umweltschutz in der Landwirtschaft erschüttert wird. Ein weiteres zentrales Problem ist das Tierwohl.
In Megabetrieben werden Tiere auf engstem Raum gehalten, was das Risiko für Krankheiten und Stress erhöht. Die Bedingungen widersprechen häufig den Anforderungen an artgerechte Tierhaltung und haben auch ethische Implikationen. Die industrielle Tierhaltung wird außerdem mit dem Rückgang der Artenvielfalt in Verbindung gebracht. Die extensive Nutzung von Flächen für die Tierproduktion und der Einsatz von Futtermitteln aus Monokulturen wirken sich negativ auf Vogelpopulationen, Insekten wie Schmetterlinge und sogar auf Baumarten aus. Die Zunahme der Megabetriebe bedeutet jedoch nicht nur ökologische und ethische Herausforderungen, sondern auch wirtschaftliche und soziale Spannungen.
Kleinbauern werden vermehrt vom Markt verdrängt, da sie mit der hohen Produktivität und den niedrigeren Preisen der industriellen Betriebe nicht konkurrieren können. Die Einkommensunterschiede zwischen großen Agrarunternehmen und kleineren Betrieben wachsen und führen zu einer Polarisierung der landwirtschaftlichen Landschaft. Zudem stehen viele Kommunen vor einem Zielkonflikt zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz. In Regionen wie Norfolk in Großbritannien, das als „Megabetriebskapital Europas“ bezeichnet wird, ist die Anzahl der Megabetriebe besonders hoch. Dort leben über 25 Millionen Tiere in industriellen Anlagen.
Kommunale Behörden stehen immer wieder vor kontroversen Entscheidungen, wenn neue Megaprojekte beantragt werden. Beispielsweise wurde ein Betrieb mit geplantem Bestand von fast 900.000 Hühnern und Schweinen aufgrund von Bedenken hinsichtlich Luftverschmutzung, Wasserknappheit und Klimafolgen abgelehnt. Die europäische Politik steht angesichts der rasanten Verbreitung von Megabetrieben vor großen Herausforderungen. Während die Europäische Kommission einerseits verspricht, die Tierwohlstandards zu verbessern und nachhaltigere Agrarsysteme zu fördern, zeigt die Praxis oft eine Diskrepanz zwischen Zielen und Umsetzung.
Tierschutzorganisationen und Umweltverbände fordern eine starke Regulierung, die einerseits die Umwelt schützt und andererseits die Tiere würdiger behandelt. Eine zentrale Forderung ist die Umleitung von Fördermitteln hin zu nachhaltigeren und kleineren Betriebskonzepten, die weniger umweltschädlich sind und besser in regionale Ökosysteme eingebettet werden können. Die Politik muss zudem sicherstellen, dass Verstöße gegen Umweltauflagen konsequent verfolgt und geahndet werden, um weiteren Schäden entgegenzuwirken. Gleichzeitig bedarf es einer umfassenden Information und Beratung für Landwirtinnen und Landwirte, um den Übergang zu umweltfreundlicheren Systemen zu unterstützen. Der Ausbau von ökologischer Landwirtschaft, Agroforstsystemen oder gemischten Betrieben kann einen vielversprechenden Weg darstellen.
Der gesellschaftliche Diskurs über Landwirtschaft und Ernährung in Europa dreht sich immer stärker auch um Fragen des Konsums. Die Nachfrage nach Fleischprodukten aus intensiver Haltung wird durch Bewusstseinsbildung und Verbraucherentscheidungen in den kommenden Jahren großen Einfluss auf die Entwicklung des Agrarsektors haben. Zahlreiche Initiativen werben für einen bewussteren Umgang mit tierischen Produkten und eine verstärkte Wertschätzung regionaler und ökologischer Erzeugnisse. Die Expansion der Megabetriebe in Europa steht exemplarisch für einen tiefgreifenden Wandel in der Landwirtschaft, der zugleich Chancen und Risiken birgt. Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, die hohe Produktivität mit Umweltschutz, sozialer Gerechtigkeit und Tierwohl in Einklang bringen.
Nur durch ein gemeinsames Engagement von Politik, Landwirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft kann eine zukunftsfähige und nachhaltige Agrarlandschaft entstehen, die den vielfältigen Anforderungen gerecht wird. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, wie dringend ein Umdenken notwendig ist. Europa steht am Scheideweg zwischen einem unveränderten Bewahren der industriellen Tierhaltung und der Förderung von vielfältigen, ökologisch verträglichen und sozial ausgewogenen Agrarsystemen. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die Weichen für eine Landwirtschaft zu stellen, die sowohl den Menschen als auch der Natur gerecht wird.